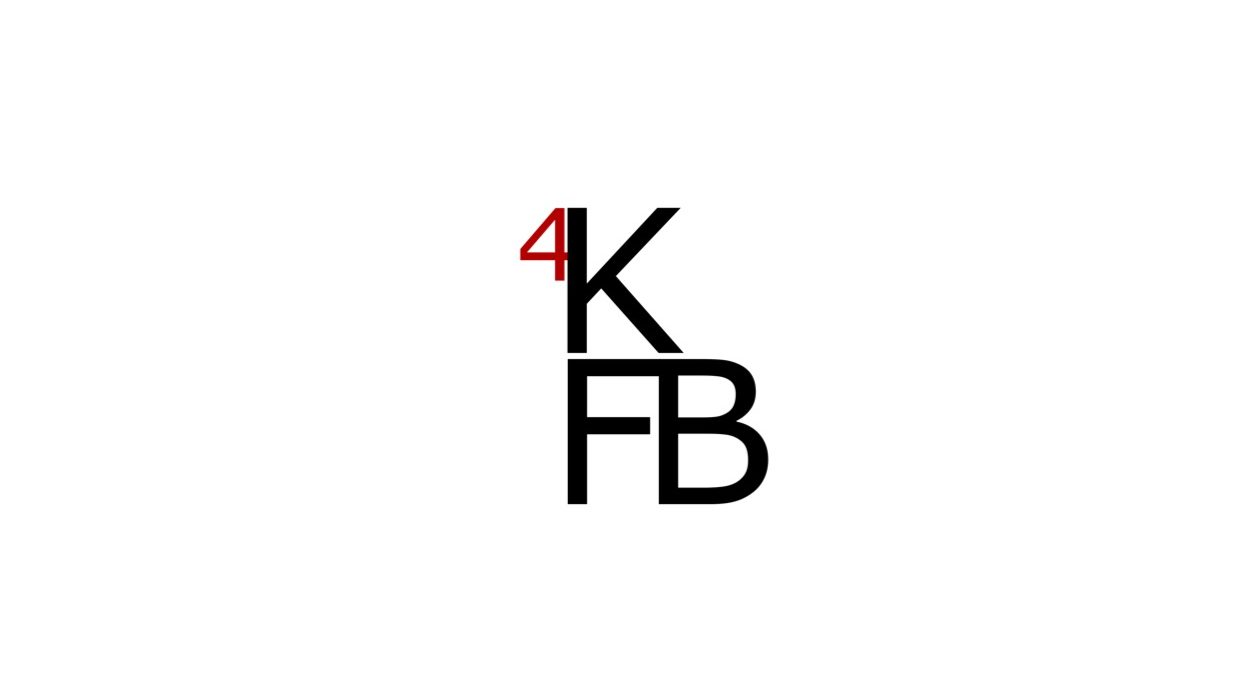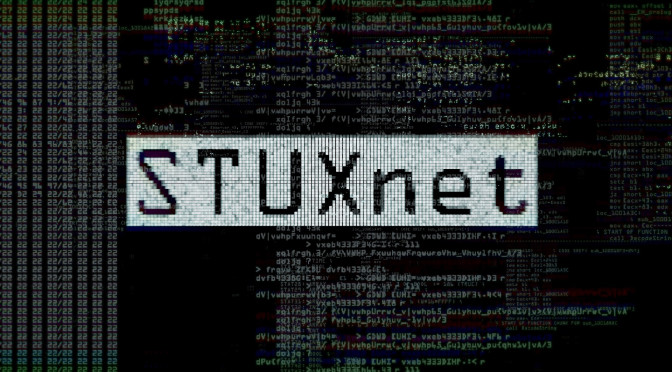Dieser aufwendig produzierte Dokumentarfilm von Alex Gibney wird wahrscheinlich einen Preis bekommen. Einfach, weil sein Thema so aktuell und politisch ist und um seine investigative Arbeit anzuerkennen: Es geht um „stux net“, den berüchtigten Computer-Virus, der vor inzwischen schon einigen Jahren durch die Medien ging und von dem bis heute niemand so recht sagen, wo er eigentlich herkam und was sein Zweck gewesen ist. Klar schien bisher nur, dass er weiträumigen Schaden angerichtet hat, nicht zuletzt in den USA, dass er außergewöhnlich raffiniert programmiert war, was eine staatliche Beteiligung wahrscheinlich macht, und dass sein eigentlicher Einsatzzweck mit der Sabotage des iranischen Atomprogramms zu tun gehabt zu haben scheint. Der Film bestätigt nun all dieses Halbwissen, aber er versucht vor allem, die Einzelheiten dieser Geschichte herauszufinden und vermitteln: durch eine Vielzahl von Insider-Interviews mit den Antivirus-Experten die StuxNet entdeckt und analysiert haben, einem Journalisten, der ein Buch über Cyberwars geschrieben hat, sowie (und dafür wird es einen Preis geben) mit verschiedenen Geheimdienstleuten von CIA, NSA und Mossad.
Kategorie: Berlinale 2016
Diary of a Sorrowful Mystery — Hele Sa Hiwagang Hapis
Hele Sa Hiwagang Hapis
A Lullaby to the Sorrowful Mystery
Am Donnerstag lief Hele Sa Hiwagang Hapis- A Lullaby to the Sorrowful Mystery im Wettbewerb der Berlinale an. Der Regisseur, Lav Diaz, ist vor allem für seine langen Werke bekannt, die sich meist mit der Geschichte seines Heimatlandes, den Philippinen auseinandersetzen. Für diesen Ansatz wurde Diaz bereits mit zahlreichen Preisen bedacht, zuletzt mit dem Goldenen Leoparden, dem Hauptpreis der Filmfestspiele von Locarno. A Lullaby to the Sorrowful Mystery beschäftigt sich mit der Geschichte von Andres Bonifacio, der als Vater der philippinischen Revolution verehrt wird. Dafür nimmt sich der Film 485 Minuten, in Worten: ACHT STUNDEN UND FÜNF MINUTEN lang Zeit. Das wirkte erstmal natürlich abschreckend. Da ich aber der Meinung war, dass wir diesen außergewöhnlichen Wettbewerbsbeitrag in unserem Blog behandeln sollten, habe ich mich morgens um halb zehn ins Kino gewagt, um eine Kritik und eine Art Erfahrungsbericht zum Erlebnis ‚Achtstundenfilm‘ zu verfassen. Was folgte, war eine der anstrengendsten und – pardon my French – beschissensten Kinoerlebnisse, an die ich mich erinnern kann. Bevor ich besonders auf den Film eingehe, möchte ich nun, als eine Art Selbsttherapie, meine Erlebnisse in Tagebuchform wiedergeben. Nur kurz vorab: Nein, ich habe den Film nicht zu Ende durchgehalten, tut mir Leid euch enttäuschen zu müssen.
Donnerstag morgens. Berlinale Palast.
-0:25: Bald geht es los. Ich nehme gemeinsam mit meinem Buddy Tom, der sich bereit erklärt hat, mir bei dem Screening Beistand zu leisten, Platz auf der linken Seite in einer der vorderen Reihen des zweiten Ranges. Für alle, die noch nie im Berlinale Palast waren: ziemlich links, sehr weit oben.
Blasse Charaktere und brave Konventionen: Genius
Wenn es um die großen Werke der modernen Literatur (und um Literatur überhaupt) geht, wird oft die Arbeit der Lektoren vergessen, die in diese Bücher eingeflossen ist und sie oft erst zu dem gemacht hat, was die Öffentlichkeit dann als ‚geniales‘ Werk bestimmt. In dieser Hinsicht ist der Ansatz von Genius (Regie: Michael Grandage) durchaus lobenswert: Er zeigt beispielhaft die Bedeutung des Lektorats für die Entstehung guter Bücher, den wesentlichen Anteil, den es am ‚Genie‘ eines Werks hat, am Beispiel von Max Perkins (‚Entdecker‘ von Hemingway und Fitzgerald) und seinem ambivalenten Verhältnis zum Jungautor Thomas Wolfe in den späten 1920er Jahren. Wie gesagt, der Ansatz ist lobenswert – aber was der Film daraus macht, ist es leider ganz und gar nicht.
Europas Krisen unter dem Brennglas: Mort à Sarajevo
Dass das ‚europäische Haus‘ sich in keinem guten Zustand befindet, hören wir ja schon seit einer Weile. Mort à Sarajevo (Death in Sarajevo) von Danis Tanović nimmt diese Metapher wörtlich und projiziert die europäische Gemengelage auf ein kriselndes „Hotel Europa“ in Sarajevo, in Anlehnung an Bernard-Henri Lévys geichnamiges Theaterstück. Klingt nach einer spannenden Versuchsanordnung – aber geht sie auch auf?
Die Geister, die wir riefen: Posto avançado do progresso
Dieser Film lässt sich Zeit, viel Zeit. Und das völlig zu recht, denn er begleitet zwei Kolonialbeamte dabei, wie sie sich ein langes Jahr auf einem Handelsposten im Kongo vertreiben – im Wesentlichen mit Trinken, Rauchen und ziellosen Spaziergängen. Ihnen dabei zuzuschauen ist hingegen keineswegs langweilig: Hugo Vieira da Silvas Posto avançado do progresso (An Outpost of Progress) entwickelt in betörenden Bildern und mit subtiler Komik das Panorama weißer Überlegenheitsphantasmen gegenüber dem ‚wilden Kontinent‘ – und führt sie genüsslich, in betörender Optik ad absurdum.
Drei Chinesen mit dem Kontrabass: Trivisa
Johnnie To muss ein sehr, sehr cooler Typ sein. Johnnie Wer? Johnnie To, seines Zeichen einer der einflussreichsten Regisseure des Hong Kong- Kinos, Regisseur von über 60 und Produzent von über 70 Filmen. Der jüngste Film, in dem To als Produzent fungiert, ist Trivisa, in dem er die Rolle des Regisseurs an drei Protegées abgibt: Vicky Wong, Jevons Au und Frank Hui, die hier ihre Regiedebüts abliefern. Johnnie To gab den Dreien eine lose Storyvorgabe, und ließ sie anschließend gewähren, ohne sich großartig einzumischen. Auf der Berlinale konnten wir nun sehen, ob sich dieses Experiment gelohnt hat.
Die Entsolidarisierungsmaschine: Yarden
Flackernde Lichter in nachtschwarzem Wasser, dazu dräuende klassische Musik. So beginnt Yarden (The Yard), von Måns Månsson, und diese Ouvertüre ist gut gewählt als symbolischer Einklang auf das Folgende. Sie nimmt die bedrückende Verlorenheit vorweg, die in zunehmender Intensität das Filmgeschehen bestimmen wird. Und fasst in einem Bild die Lage eines Menschen, der am unteren Ende der neoliberalen Hackordnung angekommen ist. Yarden erzählt von einem solchen Menschen.
Ein Film zum Bügeln – aber gut: L‘ avenir
Wenn sich eine Tür schließt, öffnet sich eine neue, sagt man. Bezüglich Mia Hansen-Løves neuem Film L‘ avenir könnte man diese Binsenweisheit etwas abändern: wenn sich alle Türen gleichzeitig schließen, sollte man vielleicht mal abschalten und nach draußen. Nathalie, Philosophielehrerin und bourgoise Intellektuelle in ihren Fünfzigern, verliert in relativ kurzer Zeit fast alles, über das sie in den letzten Jahrzehnten ihre Identität definiert hat. Mann weg, Kinder aus dem Haus, Mutter im Altersheim, um nur einige Veränderungen zu nennen, die die von Isabell Huppert verkörperte Protagonistin direkt in eine Sinnkrise steuern. Ihre nun einsetzende Selbstsuche bildet das Kernstück dieses zwar gemächlichen, aber sehr charmanten und reflektierten Dramas.
Gefangen zwischen Welten – Mãe só há uma
Der Hauptcharakter in Anna Muylaerts neuestem Film Mãe só há uma (Don’t call me son), ist zwischen Welten gefangen – zwischen einer Familie, die Jahre lang nach ihm gesucht hat und einer, die durch das Gesetz zerstört wurde, und gleichzeitig zerrissen zwischen verschiedenen Entwürfen seiner selbst. Muylaerts gewann letztes Jahr mit Que horas ela volta den Panorama Publikumspreis auf der Berlinale. Dieses Jahr kehrt sie also zurück. In Mãe só há uma behandelt sie Fragen von Familie, Identität und Sexualität virtuos und charmant durch die Augen eines jungen Mannes.
Vom Sterben eines Schmugglers – Curumim
Marco Archer Moreira, genannt Curumim, war der erste brasilianische Staatsbürger, der von einer ausländischen Regierung hingerichtet wurde. 2004 wurde er am Flughafen von Jakarta mit 13,5 Kilogramm Kokain erwischt und nach einer 15-tägigen Flucht festgenommen, von indonersischen Behörden zum Tode verurteilt und nach 11 Jahren Haft im Januar 2015 durch ein Erschießungskommando hingerichtet.
In der Dokumentation Curumim widmet sich der brasilianische Regisseur Marcos Prada Moreiras Lebensgeschichte. Hierfür standen ihm nicht nur mehrere Stunden Telefonaufzeichnungen, zahlreiche Briefe und Interviews mit Curumims Weggefährten zur Verfügung: Moreira, selbst Ideengeber des Films, zeichnete ab 2012 über drei Jahre mit einer versteckten Kamera seinen Haftalltag auf und schickte das daraus entstandene Material an Prado, auf dass der die besten Ausschnitte für den Film benutze.