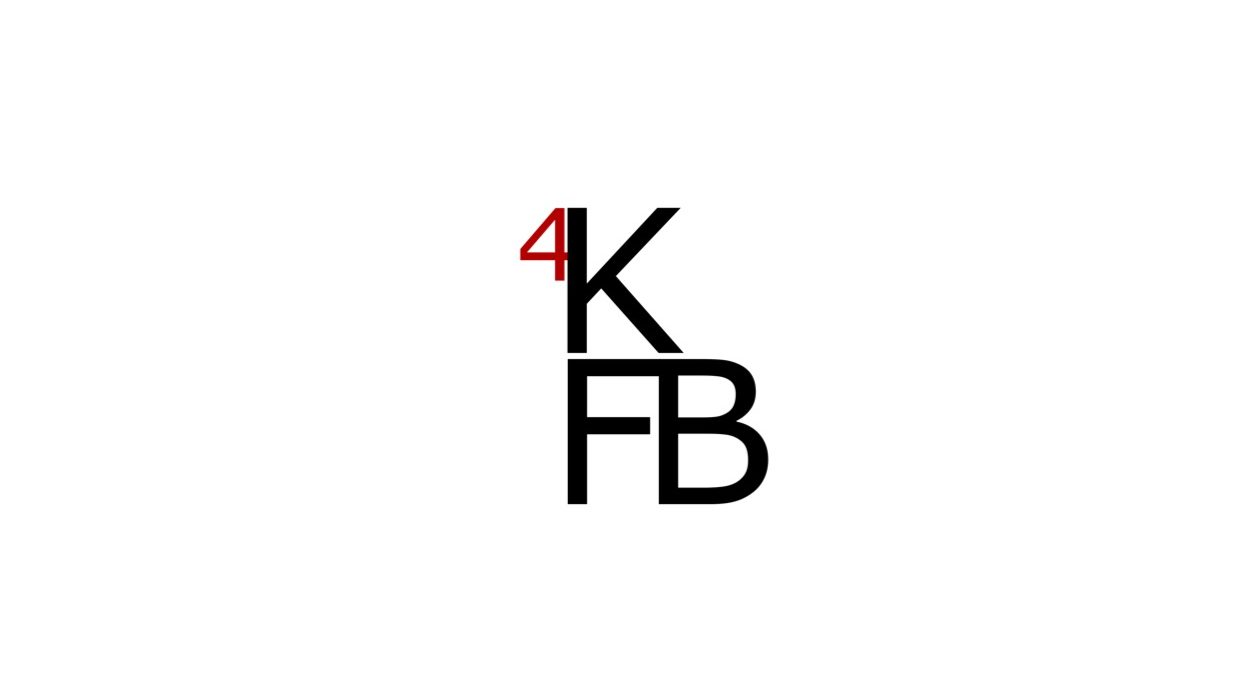Mit Alterswerken ist das so eine Sache, gerade bei den „abgedrehten“ Regisseuren: Kompromisslos werden sie, aber manchmal erweist sich diese Kompromisslosigkeit eher als Träger von Renitenz denn von künstlerischem Furor. Während beispielsweise David Lynch mit Twin Peaks: The Return ein Meisterwerk abgeliefert hat, ist Alejandro Jodorowsky’s Endless Poetry zu einer langweiligen Verklärung der eigenen Biographie geronnen. Wo auf dieser Skala lässt sich da Ferrara einordnen? Nehmen wir hier nur Siberia und nicht Tomasso, Ferarras vorherigen Film, als Anhaltspunkt und schauen mal, worum sich Siberia denn überhaupt dreht.
Clint (Willem Dafoe) leitet eine Art Kneipe in der arktischen Tundra, vereinzelt kommen Gäste zu Besuch und sprechen in Sprachen mit ihm, die er nicht versteht. Ein ebenfalls von Dafoe gespielter Mann (sein Bruder?) kümmert sich um Schlittenhunde. Ein Gast sitzt vor einem einarmigen Banditen, Clint unterhält sich mit ihm, vielleicht wird es ja diesmal was, zweimal kam die 9 schon, da ist die dritte, ganz langsam, vielleicht wird es – BÄRENATTACKE! DER BÄR FRISST WILLEM DAFOE, AAH, ER SCHREIT GANZ DOLLE, UND DER BÄR IST AUCH SO LAUT, WHAA, OH MEIN GOTT, DER BÄR – und wieder Stille, weiter rumhängen in der Absteige. Falls man auf der Toilette war, keine Sorge, solche völlig abrupt und ansatzlos eingeschobene Momente härtester und lautester Brutalität ziehen sich durch den ganzen Film. Dabei wird auch vor der Mottenkiste der Höllenkreise nicht zurückgeschreckt – freut euch auf Nazi-Exekutionen und Gedärme.
So stellt sich beim Publikum eine latente Anspannung ein, wann denn die nächste Jump Scare Ohrfeige kommt, und das ist immerhin ein Gefühl, das Siberia hervorruft – ein sehr unangenehmes und plump erzeugtes Gefühl, aber ein Gefühl. Dieses Unwohlsein lenkt freilich von den ruhigen Sequenzen ab, in denen Clint eine Reise durch die Arktis, die Wüste und in sein Inneres bestreitet – aber soviel gibt es da ohnehin nicht zu sehen. Meist trifft Clint auf seinen Vater, seinen Bruder oder sein anderes Ich, die allesamt von Willem Dafoe (und das immerhin sehr distinkt unterschieden) verkörpert werden, und schwadroniert mit ihnen darüber, was denn nun sein Selbst sei, ob er Mann genug sei, wie schlimm seine vergangenen Untaten so waren und wo denn die dunklen Magier seien. Oder er trifft Frauen, die entweder schon nackt sind oder sich irgendwann ausziehen, mit denen redet er kaum.
Dabei wechseln scheinbar bezugslos und unmotiviert Szenerie, Figuren und Themen auf einem Tempo, das Kohärenz gänzlich verunmöglicht. Im Gegensatz zu gutem surrealistischem Kino wird hier aber kein filmischer Code erzeugt, in dem Assoziationen zueinander möglich sind und mit dem ein Geflecht der Bedeutungen entstehen kann. Der einzige verknüpfende Bezugspunkt am Horizont bringt einen dunklen Verdacht mit sich: Ist das alles autobiographisch gemeint? Eine kurze Google-Suche im Nachhinein zeigt, dass Clints Kind von Ferraras Tochter gespielt wird, und seine Frau Cristina Chiriac im Film als hochschwangere Russin auftaucht (und sich nach kurzer Zeit auszieht, natürlich). Und immer wieder mit dem Vater reden, auch wenn jeder Konflikt nur angedeutet bleibt. Das einzige, was diesen 90-minütigen Haufen zusammenhält, scheint der kompromisslose (Alterswerk) Wille Ferraras zu sein, sich mit seiner Vergangenheit und seinem Selbstbild zu beschäftigen. Dabei liegt das eigentliche Ziel weniger in der Analyse, kommen die verhandelten Konflikte doch kaum über die Kennenlernsitzung bei dem oder der Therapeut*in hinaus. Oha, der Vater hat eine Pistole. Die Mutter liegt auf Clint und erdrückt ihn fast. Teenager sind gemein zu ihm. Stattdessen geht es, Ferrara-typisch und sehr katholisch, um Schuld und Sühne – bzw. vor allem um Vergebung, die sich Ferrara auf filmische Weise selbst erteilt. So kann Clint seiner Ex-Frau sagen, seine einzige Schuld läge darin, sie zu sehr zu lieben. Und wenn Clints Mutter ihm dann noch bereitwillig vergibt, dass er bei ihrem Tod nicht bei ihr war – „Du bist schließlich beschäftigt gewesen“ – dann sehne ich mich zurück zur Bärenattacke, oder zu Jodorowsky‘s Endless Poetry.
Sven
Sektion: Wettbewerb Italien / Deutschland / Mexiko 2020 Regie: Buch: Mit: Willem Dafoe, Dounia Sichov, Simon McBurney, Cristina Chiriac Länge: 92’
Bildmaterial: Berlinale Filmstills: Wettbewerb