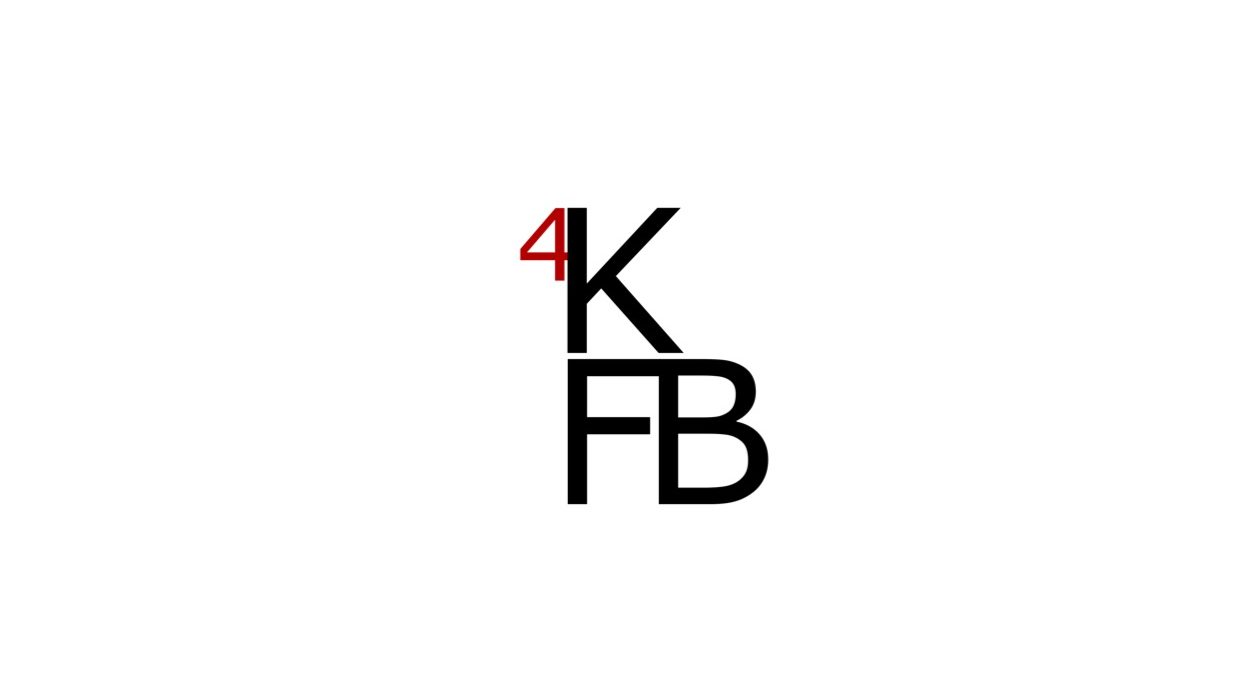Ein „dokumentarischer Spielfilm“ über Menschen, die bei ihrem Suchen nach und Versuchen mit der Liebe begleitet werden – und dabei „sich selbst spielen“. Klingt spannend! Geht aber leider gehörig in die Hose.
Das liegt vor allem daran, dass die Wette auf die hybride Form – dokumentarisch, aber mit inszenierten Elementen – nicht aufgeht. Statt die Grenzen zwischen beiden Formen zu verwischen und auch die inszenierten Szenen dokumentarisch wirken zu lassen, passiert genau das Umgekehrte: Auch die dokumentarischen Szenen bekommen zu großen Teilen etwas gekünsteltes, wirken aufgesetzt. Dem Film gelingt genau das nicht, was intime Dokus ausmacht (und was der Regisseur Tamer Jandali nach der Vorführung für sich beanspruchte), nämlich die Gefilmten die Kamera vergessen zu lassen. In easy love hingegen wirken der Umgang und das Sprechen zwischen den Auftretenden allzu oft zu emphatisch, zu wohlartikuliert, zu sehr für ein Publikum gesagt und getan, als dass es sich ‚echt‘ anfühlen könnte. Heraus kommt ein Film, der weder den Kriterien des Dokumentarischen, noch des Spielfilms genügt: Er wirkt eben wie schlecht gespielt.
Das ließe sich durch eine Reflexion dieser „Künstlichkeit“ innerhalb des Filmes aufwiegen – aber auch die vermisst man schmerzlich. Das ‚Spielen-sich-selbst‘, das im Vorspann die Figuren ankündigt und einordnet, hätte als Bekenntnis zur Differenz, zur Spaltung interpretiert werden können. Die Betonung läge dann auf dem Spielen, das zwischen das spielende Ich und das gespielte Selbst tritt. Tatsächlich erhebt der Film damit aber offenbar doch nur einen banalen Anspruch auf Identität: Betonung auf sich selbst, also total authentisch und so.
Dieses harsche Urteil gilt nicht für alle Passagen des Films – es gibt durchaus Erzählstränge (etwa einen, der der Beziehung zweier lesbischer Frauen folgt) und Szenen, die sich ‚echt‘ anfühlen und teilweise berühren. Leider bleiben diese Momente aber die absolute Ausnahme und finden sich eher im letzten Viertel des Films, nach über einer Stunde pseudo-tiefsinniger Reflexion. Easy love bleibt so über weite Strecken hölzern und erstaunlich langweilig, wenn man bedenkt, dass es um Liebesdinge, Herzschmerz usw. geht – und dass beinahe obsessiv immer wieder vögelnde Menschen gezeigt werden (und zwar fast ausschließlich in den heterosexuellen Konstellationen). Es ist bezeichnend, dass gerade diese Sexszenen völlig kalt lassen und auch sonst von Liebe oder Leidenschaft nur wenig zu spüren ist.
Dass der Film so wenig berührt, liegt auch an der Musikvideo-Ästhetik, die jede einzelne Einstellung durchzieht und warenförmig macht – in weiten Teilen lässt sich easy love kaum von einer Werbung für das Lollapalooza-Festival unterscheiden. Das geht so weit, dass in den 85 Minuten Laufzeit nicht ein, sondern zwei tatsächliche Musikvideos untergebracht wurden. Überrascht es da noch, dass die verschiedenen Handlungsstränge völlig unterentwickelt bleiben?
Constantin und Sven
easy love Länge: 85' Regie: Tamer Jandali Mit: Produktion:
Bildmaterial: Berlinale Filmstills; Panorama