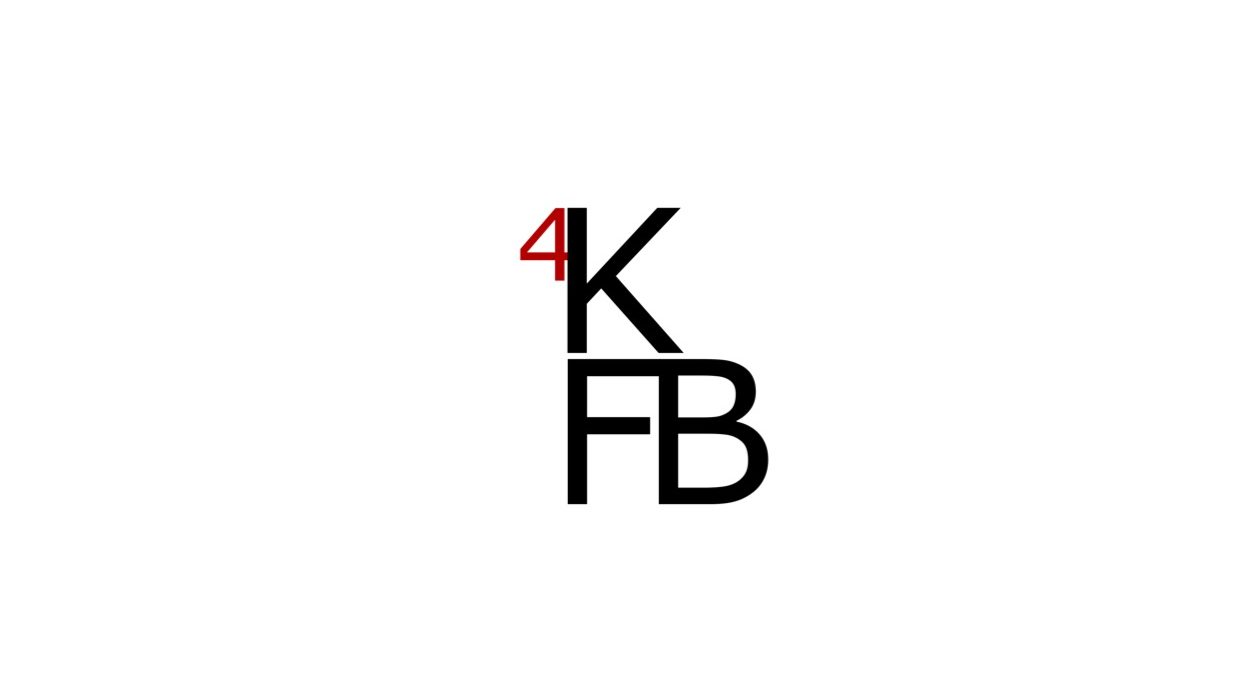Dieses Sounddesign! Ich schließe die Augen, in der Ferne höre ich die Schläge eines Presslufthammers, ein dumpfes unterschwelliges Sirren mischt sich mit dem Knacken von brennendem Holz, das um sich zu greifen beginnt – und die plötzliche, viel zu laute Vibration eines Handys lässt mich zusammenfahren. Augen wieder auf, es brennt gar nicht, das Sirren ist aber zu einer Wand angeschwollen, die auf meine Brust drückt und mir dieselbe Raumangst einflößt, die auch die Protagonistin von Ceylan Özgün Özçeliks fabelhaftem Debütfilm Kaygi (Inflame) umfängt.
Besagte Hauptperson Hasret (Algı Eke) arbeitet als Cutterin im Journalismus der heutigen Türkei und wird nicht nur von der ununterbrochen auf sie einprasselnden medialen Angstmaschinerie der Politik zermürbt, sondern auch von der Simplifizierung und Verfälschung der Nachrichten, die sie im Schnittraum auf Weisung selbst vornehmen muss. Ihr verinnerlichtes Misstrauen beginnt schnell, sich nicht nur gegen die gegenwärtige Regierung zu richten, die zudem Hasrets alte Wohnung abreißen und das ganze Viertel in eine Mall verwandeln möchte, sondern auch in die Vergangenheit auszugreifen: Wie sind ihre Eltern, als Hasret noch ein Kind war, wirklich ums Leben gekommen?
Während die ersten Minuten ihrer Ermittlungen sich zugegebenermaßen noch etwas in die Länge ziehen, nimmt Kaygi an Fahrt und Intensität auf, sobald sich Hasrets Paranoia verschärft und sie sich isoliert mit ihrer Vergangenheit und deren Gegenständen (Fotos, Bilder, Tonbandaufnahmen) zuhause einschließt. Ab diesem Moment kann die meist minimalistische, bisweilen aber expressiv werdende Filmsprache Özçeliks, verbunden mit der bereits erwähnten Tongestaltung eine klaustrophobische, teilweise ins Alptraumhafte abgleitende Atmosphäre verdichten in der die Grenze zwischen Realität, Wahnvorstellung und Erinnerung nicht nur verschwimmt, sondern vollends aufgehoben wird. Wenn „die Wände zu heiß“ sind, ist das nämlich nicht nur Halluzination, sondern zu gleichen Teilen auch Verweis auf die Vergangenheit und Metaphorisierung der Gegenwart. Kaygi verlagert die Aufarbeitung eines nationalen Traumas – beziehungsweise gerade das Fehlen dieser Aufbereitung – in die individuelle Psyche seiner Hauptperson und wirkt dabei in seinen besten Momenten fast wie ein etwas abgeschwächter David-Lynch-Film oder eine der frühen Arbeiten Roman Polanskis – viel größeres Lob lässt sich wohl nicht formulieren.
Gerade das Fehlen eines soziologischen Blickes oder erhobenen Zeigefingers auf die politischen Verhältnisse in der Türkei heute und vor zwei Jahrzehnten, als 1993 bei einem Brandanschlag auf ein alevitisches Künstlerfestival in Sivas 36 Menschen ermordet wurden, macht den einzigen türkischen Beitrag auf dieser Berlinale dabei auch politisch wirksam. Anstatt offen zu moralisieren, irritiert der Film zunächst als Psychothriller sein Publikum, um diese Verstörung erst nachträglich als Plädoyer gegen staatliche Zensur und für ernsthaften Journalismus fruchtbar zu machen. Kaygi funktioniert also sowohl als Persönlichkeitsstudie, als auch als gesellschaftskritische Parabel. Und habe ich das grandiose Sound-Design schon erwähnt? Nach einem Tag hallen mir die geisterhaften Schritte aus Hasrets Appartment noch immer durch den Kopf. Empfehlung!
Sven
Bildmaterial: Berlinale Filmstills, Sektion: Panorama