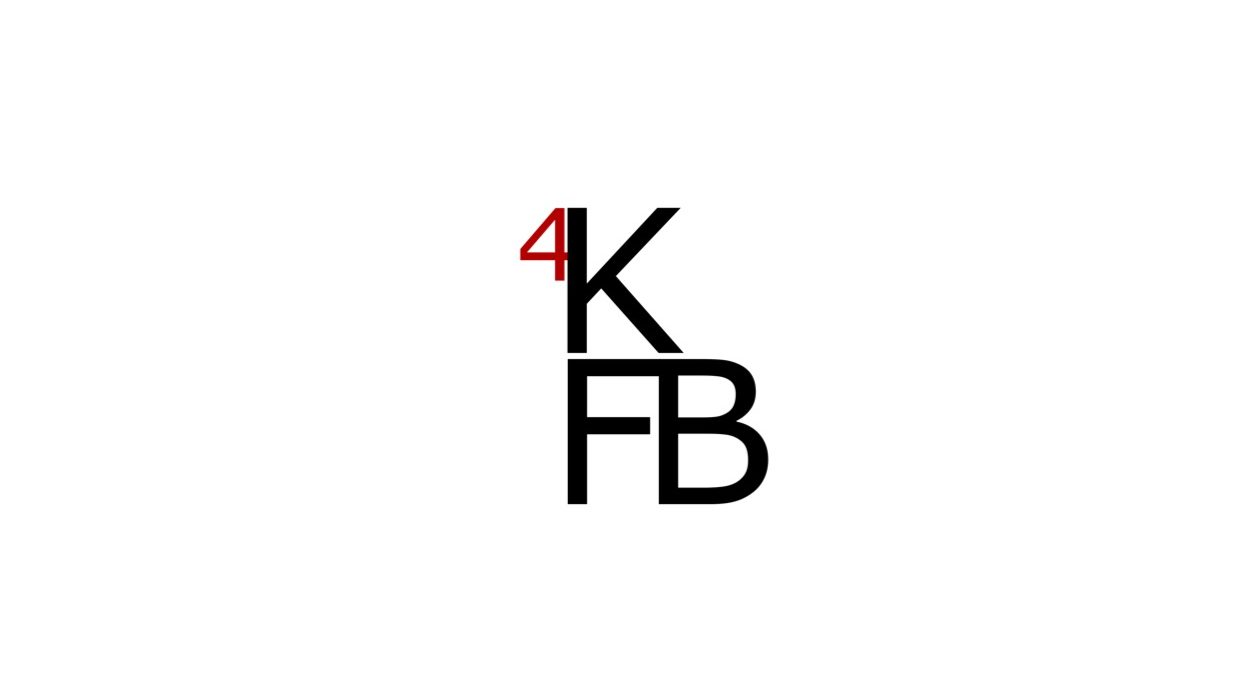Was muss ein Eröffnungsfilm alles leisten? Diese Frage stellen wir jedes Jahr aufs Neue und das sollte sich jetzt ändern; stattdessen möchte ich Django von Etienne Comar, den offiziellen Einstand dieser Berlinale, einfach für sich nehmen und nur die Frage beantworten: Lohnt der sich? Leider kommt er auch ohne das Handicap ein Festival eröffnen zu müssen nicht viel besser weg.
Doch zunächst auf Anfang: Django Reinhardt ist der bekannteste Musiker im besetzten Paris 1943. Mit seiner Mischung aus Jazz, französischem Walzer und traditioneller Romamusik bringt er deutsches wie französisches Publikum zum Mitwippen und Tanzen. Die Besatzer kriegen das mit und wollen Djangos Musik für sich instrumentalisieren, ihn durch Deutschland touren und dort traditionelle Musik spielen lassen. Um diesem Zwang zu entkommen und sich und seine Familie vor den willkürlichen Verhaftungen und Deportationen von Sinti und Roma in Frankreich zu schützen, beschließt Django widerwillig, die Stadt zu verlassen und in die Schweiz zu fliehen. Unterstützt wird er dabei von einer französischen Geliebten, die sich mit den Nazis einlassen muss, und einer Zelle der Resistance, die aber Gegenleistungen erwartet.
Nun handelt es sich beim titelgebenden Django um einen begnadeten Musiker, der mit lediglich zwei Fingern seiner Greifhand einen komplett eigenen Gitarrenstil entwickelte – was sich bei einem zwar halbwegs charismatischen, aber offensichtlich nicht mit musikalischem Genie ausgestatteten Schauspieler schwierig rüberbringen lässt. Schließt man die Augen, funktioniert die an und für sich großartige Musik (die den besten Part des Films darstellt) gut; öffnet man sie jedoch, vermittelt Reda Kateb trotz viel Einsatz und zahllosen Close-Ups auf die Hände Djangos das Bild eines Mannes, der so tut, als würde er virtuos Gitarre spielen. Ist sie nicht mit solchen Nahaufnahmen beschäftigt, weiß die Kamera gerade in der ersten Hälfte des Filmes nicht so richtig, wohin, und wechselt scheinbar willkürlich von wackeliger Handkamera zu Totalen zurück zu Close-Ups, ohne, dass dahinter ein Konzept erkennbar wäre. Im späteren Verlauf des Filmes erdet sich die Kamera zwar etwas, dafür treten dann aber die Karikatur-Nazis auf und machen Karikatur-Nazi-Kram: böse gucken, eindimensionale Arschlöcher sein und in zwar korrektem Deutsch, aber furchtbar monoton und hölzern Befehle bellen.
Mit diesen stereotypen Antagonisten kann Django auch zur stereotypen Heldengeschichte werden, inklusive Erlösungsgeschichte, glattgebügelter Ästhetik und heroischem Einsatz mit sehr viel „Spannung“. Der echte Django Reinhardt ist übrigens an der Schweizer Grenze abgewiesen worden, nach Paris zurückgekehrt und hat dort von den Nazis relativ unbehelligt weitergelebt – das wurde von den Filmemachern kurzerhand unter den Teppich gekehrt und eigentlich wäre das auch in Ordnung, wenn die Filmemacher mit den Fotos von tatsächlich verfolgten Sinti und Roma vor dem Abspann Django nicht im Nachhinein noch einen politischen Anstrich zu geben versucht und ihn damit als „das ist alles so passiert“ ausgewiesen hätten. Schlamperei!
Sven
Bildmaterial: Filmstill Berlinale, Sektion: Wettbewerb