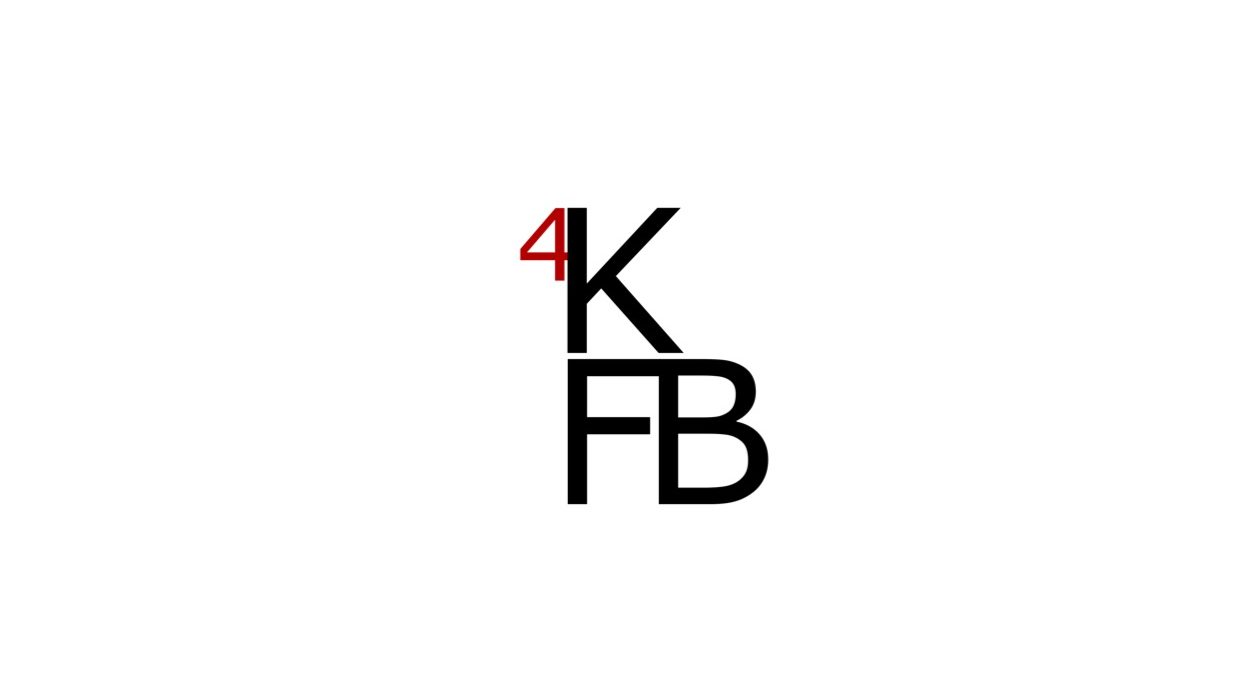Ich muss ja gestehen: Ich bin ein ziemlicher Fan des iranischen Kinos – nicht, dass ich mich damit sonderlich gut auskennen würde. Aber in den letzten Berlinale-Jahren gab es fast immer einen iranischen Film, der mich auf besondere Weise begeistert oder fasziniert hat. Dieses Jahr kam dafür nur ein Kandidat in Frage: Nasht (engl. Leakage) von der Regisseurin (!) Suzan Iravanian. Entsprechend hoch waren meine Erwartungen. Wurden sie erfüllt? Leider nur in den ersten 30 Minuten.
Der Anfang ist vielversprechend: Wir folgen einer Frau Ende 50, ihr Gesicht, gerahmt von schwarzen Haaren und Kopftuch, zeigt einen unbestimmten Schmerz, eine ferne Irritation. Ihr Mann, Angestellter der staatlichen Ölgesellschaft, ist vor einiger Zeit verschwunden, sie weiß nicht, wohin. Es steht nur ein Verdacht im Raum: „Sie“ sind hinter ihm her gewesen, und nun haben „sie“ es womöglich auch auf seine Frau abgesehen. Seither wird sie von einem merkwürdigen Symptom geplagt, das uns nur nach und nach enthüllt wird: Bei emotionaler Anspannung tritt aus ihrem Körper Öl aus – dickes, schwarzes Erdöl, das an ihr herunterläuft oder, in einem der vielen starken Bilder, sich als Lache langsam auf dem weißen Laken ausbreitet. Später erfahren wir, dass ihre Ur-Großmutter das gleiche Phänomen gehabt haben soll gehabt haben soll – und das entstehende Öl gewinnträchtig verkauft hat.
Überhaupt sind die ersten Minuten geprägt von teilweise großartig gestalteten Bildern, regelrechten Tableaus. Entrückte Farben, symbolhafte Arrangements, starke Kontraste: Das erste Mal sehen wir die Protagonistin bloß als Silhouette im Türrahmen vor beinahe völlig schwarzer Leinwand – sie scheint sich aufzulösen in all dem Dunkel. Das nächste Bild zeigt ein blütenweißes Laken. Später immer wieder Durchbrüche, Löcher in Wänden oder Decken.
So wird in kurzer Zeit eine Fülle von Motiven und möglichen Interpretationen angedeutet: Öl als Bodenschatz, der den betreffenden Ländern oft nichts Gutes bringt, ebensowenig der Protagonistin (auch wenn sie ihre produktive „condition“, in einer Szene voll trockenen Humors, als Argument für ein deutsches Visum einzusetzen versucht); die Frau als Energie-Produzentin, die in einer patriarchalen Gesellschaft die männliche Vorherrschaft bedroht (und so für die Frau selbst zur Bedrohung wird). Vor allem aber scheinen die ersten Szenen zusammengenommen auf ein abstrakteres Thema zu verweisen: Begrenzungen – architektonische, national-geographische oder eben die Verschließung des weiblichen Körpers – und ihre Überschreitung bzw. Auflösung: Die Decke des Hauses bricht plötzlich ein, die Figuren wollen auswandern, der Körper wehrt sich gegen seine Abkapselung und diffundiert in die Welt hinein.
Ich war also gespannt, wie der Film mit dieser Fülle an Verweisen umgehen würde. Leider versäumt es das Skript, nach einem abrupten narrativen wie inszenatorischen Bruch, die Hinweise, Motive und Spuren zusammen- oder auch nur weiterzuführen. Die Hauptfigur und ihre engen Verwandten ziehen sich auf ein ländliches Gehöft zurück, verwaltet vom Cousin ihres afghanischen Bediensteten (wiederum taucht hier das Thema der Migration auf). Statt zu verdichten, zu synthetisieren, verliert sich der Film in zähen Szenen und weiteren Andeutungen, deren Sinn für das Narrativ oder die Botschaft wenig nachvollziehbar sind. Ohne Not gibt der Film so die Dichte (fast ein Kammerspiel) und Absurdität des Anfangs auf und macht Platz für ein opakes Hin und her auf dem Land. Der afghanische Cousin will die Erde reinhalten und sein Maßstab sind Glasflaschen mit Wasser. Häh? Genau.
Warum die Protagonistin sich hierhin flüchten muss, bleibt weitgehend unklar. Das liegt daran, dass die Atmosphäre diffuser Bedrohung – Kennzeichen diktatorischer Regime –, die anfangs immer wieder angedeutet wird, keine echte Dringlichkeit entfaltet: Sie überträgt sich jedenfalls kaum auf mich als Zuschauer. Vermutlich soll hier irgendwie auf das Verhältnis von Öl und Erde eingegangen werden – Verunreinigung etc. –, ein Aha-Erlebnis stellt sich dabei jedoch nicht ein. Die Neugier, die der erste Teil noch geweckt hatte, geht hier in Frustration und Langeweile über. So plätschert es vor sich hin, bis zu einem lauwarmen Ende, dessen Drama kaum noch verfängt. Es fehlt der Zug.
Angesichts des aussichtsreichen Starts ist das umso bedauerlicher. Klar, vielleicht hab ichs auch einfach nicht kapiert, vielleicht fehlt mir der nötige kulturelle Kontext. Das mag schon sein, aber ganz abgesehen davon, dass das nichts an der Richtungslosigkeit des zweiten Teils ändern würde: Urteilen kann man eben nur auf der Grundlage dessen, was bei einem ankommt. Die Regisseurin übrigens scheint um die Schwierigkeiten ihres Films zu wissen: Am Ende bedankte sie sich beim Publikum dafür, bis zum Schluss geblieben zu sein.
Bildmaterial: Berlinale Filmstills; Forum
Nasht (Leakage)
Sektion: Forum
Regie: Suzan Iravanian
Mit: Armik Gharibian, Ziba Eslamloo, Hasti Khaledi, Saeed Saeedy, Mohammad Saleh Ghetmiri
Produktion: Iran / Tschechische Republik
Länge: 104’