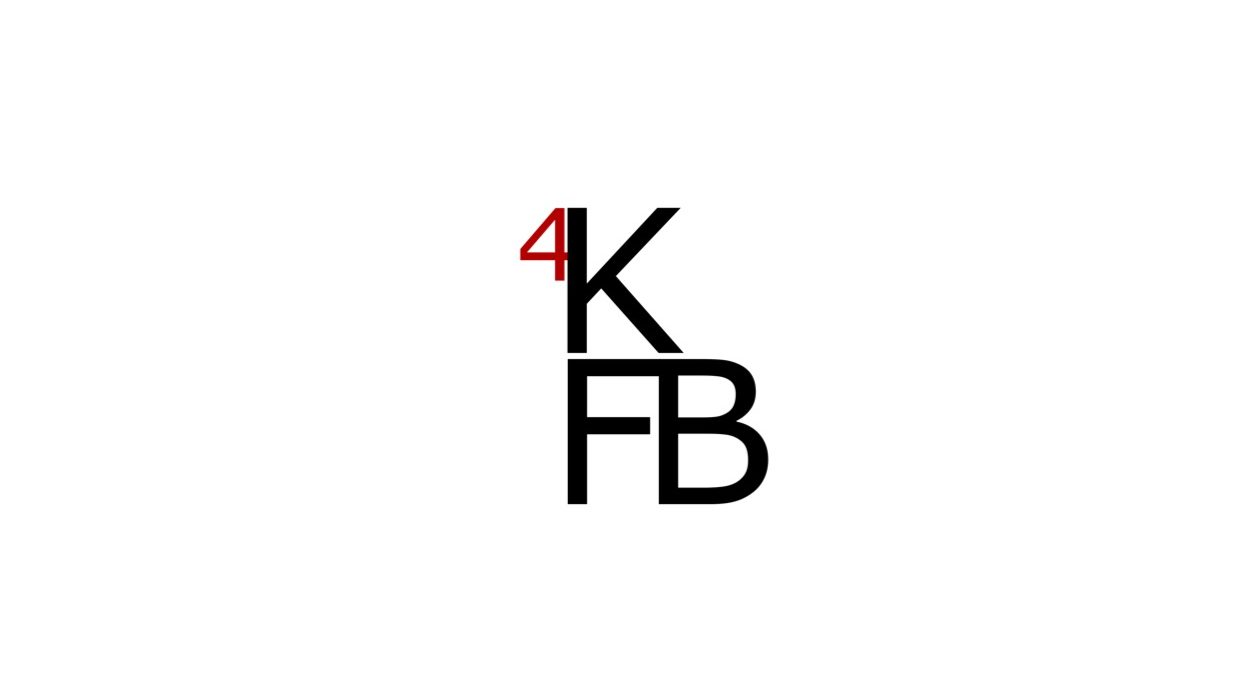Schon der zweite Verriss innerhalb von zwei Tagen und vier Filmen. Respekt, Berlinale! Respekt, Werner Herzog. Wir würden Ihnen hiermit gern ans Herz legen, das Filmemachen in Zukunft vielleicht lieber sein zu lassen… Klingt arrogant? Keine Spur. Bloß die folgerichtige Empfehlung nach dieser Zumutung. Und sein wir ganz ehrlich: Im Grunde hat Werner Herzog ja ganz offensichtlich das Filmemachen schon aufgegeben – denn, das was wir da heute vormittag über uns ergehen lassen mussten, das war nicht wirklich ein Film, sondern eher eine willkürliche Aneinanderreihung immergleicher melodramatischer Szenen.
Kommt euch bekannt vor? Stimmt, nicht nur in dieser Hinsicht sind sich Queen of the Desert und Nobody Wants the Night erstaunlich ähnlich. Die Darsteller zum Beispiel: Nicole Kidman versteht ihr Handwerk ebenso gut wie Juliette Binoche – in den Fängen eines miserablen Drehbuchs aber bleibt beiden kaum eine Möglichkeit, eine differenzierte Charakterdarstellung zu bieten (Kidman wird sogar noch mehr in Plattitüden gedrängt, als Binoche).
Oder nehmen wir den latenten Rassismus: Der Berlinale-Eröffnungsfilm mag hier noch etwas hemmungsloser vorgehen (die Inuit-Frau wird als völlig naiv und und dümmlich dargestellt, das bleibt in diesem Maße den „stolzen Arabern“ aus Herzogs Filmverschnitt erspart) – die kolonlialistisch-rassistische Grundtendenz ist aber in Queen of the Desert ebenso vorhanden – und sei es in Form ‚positiver ‚Rassismen, wie der Reduktion des ganzen „Beduinenvolks“ auf Repräsentanten von Stolz und Poesie.
Überhaupt entspricht die Darstellung der „Araber“ ziemlich genau den Bewältigungsstrategien des Kleinbürgertums gegenüber dem Fremden, wie sie Roland Barthes beschreibt: Entweder sie werden dem Eigenen einverleibt (wie der „gute“ Scheich des Drusen-Stammes, der sich – nach einem ‚barbarischen‘ Empfang durch seine Männer, die „es nicht besser“ wissen – als weitgereister und westlich kultivierter Gentleman erweist, dargestellt als alternder französischer Giggolo) oder sie werden exotisiert bzw. in die Rolle unterwürfiger Diener gedrängt. Abgesehen von Scheichs und Stammesführern übrigens erfolgt kaum ein echter Kontakt zwischen Bell und Vertretern des arabischen „Volkes“, das sie ständig zu lieben behauptet.
Paradoxerweise versucht auch dieser Film, sich einen genau gegensätzlichen Anschein zu geben: Der als Nebenfigur auftretende T.E. Lawrence (Robert Pattinson) übernimmt kurz vor Filmende das postkoloniale Gewissen des Films, indem er bemerkt, die Briten sollten sich schnellstmöglich aus ihren Kolonien zurückziehen. Die titelgebende Gertrude Bell (Nicole Kidman) wird als Befreierin der arabischen Völker inszeniert: Sie habe ihren Königen in den Thron verholfen und die Grenzen der neuen Nationalstaaten abgesteckt, ja sei „the only stranger“ von denen sich die Beduinen jemals „fully understood“ gefühlt hätten – so informiert uns zumindest, wieder einmal, der Abspann; der Film selbst spart sorgfältig alle politischen Tätigkeiten Bells aus und beschränkt sich auf die hoffnungslos idealisierten romantischen Schwärmereien der Titelheldin (s.u.). Tatsächlich aber perpetuiert die Idealisierung Bells zur weißen Heiligenfigur, die einem orientalisierten Volk von „Arabern“ ihre Gunst erweist, gerade den Kolonialismus, den der Film vorgibt anzuprangern.
Ausgerechet die anfangs als unbeugsam Emanzipierte gesetzte Bell wird schnell auf das klassische Rollenklischee für Frauen reduziert. In den endlos in die Länge gezogenen Annhäherungsszenen zwischen Bell und ihrer großen Liebe Henry (James Franco) – einem furchtbar stereotyp inszenierten geheimnisvollen aber „einsamen“ Fremden – fällt die vorher so aufmüpfige Gertrude zurück in die Rolle der gelehrigen Schülerin. Nachdem diese erste Episode endlich vorbei ist, zeigt uns Herzog im Wesentlichen bloß immer neue Variationen von Bell beim Schmachten, Dromedare Reiten, in ihr Tagebuch schreiben (wobei Kidmans Off-Stimme uns zu ihrem krampfhaft sinnierend schauenden Gesicht pseudo-poetische Lebensweisheiten aufsagt – „Je tiefer ich in dieses Labyrinth eindringe, desto mehr finde ich mich selbst“) und mit Stammesfühern über die Schönheit von Land und Leuten parlieren. Frauen betreiben halt Konversation.
Als Bell auf ihre erste Expedition aufbricht, um „archäologische Ausgrabungen“ vorzunehmen, sehen wir sie einmal kurz durch ein Landvermessungsgerät schauen. Was genau sie hier erforscht, hat uns offenbar überhaupt nicht zu interessieren (was könnte denn auch eine Frau schon zur Wissenschaft beisteuern). Das, worum Bell womöglich kämpft (so genau weiß man das auch nach dieser Filmerei nicht), nämlich als weibliche Forscherin und Intellektuelle ernst genommen zu werden, gewährt ihr der Film selbst nicht: Sie bleibt eine Frau, die als luxuriöses Hobby mal Archäologin spielt. Dafür sehen wir dann lange Einstellungen von Bell respektive Kidman, wie sie quasi nackt ein Bad in der Wüste nimmt. Männer zeigen Filme und Frauen ihre Brüste…
Auch in diesem Machwerk wird übrigens alles noch schlimmer durch den musikalischen Retorten-Kitsch, der bei jeder Gelegenheit unter die Bilder gelegt wird – wohl aus der berechtigten Sorge, dass die Bilder allein eher lächerlich als berührend wirken würden. Das Allerschlimmste aber (und eine Unterbietung gegenüber Nobody Wants the Night) ist das Fehlen jeglicher Handlung. Am Ende beschreibt Bell ihre Zeit im Nahen Osten als „years of preparation for I don’t know what purpose“ – das fasst diese kuriose Ansammlung von Szenen ziemlich gut zusammen.
Fazit: Nobody wants „Nobody wants the Night“ all over again.
Costja
(Bildmaterial: Berlinale Filmstill, Sektion: Wettbewerb, außer Konkurrenz )