Eigentlich wäre es dieser Film gar nicht wert, viele Worte darüber zu verlieren – wäre, wenn ihn nicht die Berlinale-Organisatoren aus unerfindlichen Gründen zum Eröffnungsfilm der Festspiele ernannt hätten und wenn er uns in seiner melodramatisch überhöhten Minderwertigkeit und seinem schlecht versteckten Rassismus nicht so wahnsinnig empören würde. So aber müssen wir dann doch ein paar Worte dazu sagen: Nadie Quiere la Noche (so der Originaltitel) von Isabel Coixet ist repetitiv, pathetisch, latent rassistisch und so langatmig, dass wir oft kurz vorm Einschlafen gewesen wären – hätten wir uns vor lauter Verzweiflung nicht ins Augenrollen und Wütend-in-die-Sitzkissen-Boxen geflüchtet. Dieser Film ist gerade in seiner zweiten Hälfte eine Beleidigung – Punkt.
Der Plot des Films – der auf „real characters“ basiert, wie der Vorspann betont – , ist schnell erzählt: Die Gattin des Polarforschers Robert E. Peary reist 1908 ihrem Mann, der von seiner „finalen Expedition“ noch nicht zurückgekehrt ist, gen Norden hinterher. Durch widrige Umstände und blinde Tollkühnheit strandet sie im letzten Vorposten und muss dort allein mit einer Inuit-Frau überwintern. (Surprise: Diese hatte was mit ihrem Mann und nun warten sie beide auf Mr. Peary.) Die Figuren warten auf das Ende des polaren Winters – die Zuschauer warten sehnlichst auf das Ende der zweistündigen Pathos-Orgie.
Der einzige Pluspunkt: Juliette Binoche spielt ihre Rolle der unerträglich eingebildeten Oberschichtsgattin sehr überzeugend – so überzeugend, dass sie einem nach spätestens 20 Minuten wahnsinnig unsympathisch geworden ist. Für ihr schauspielerisches Können hat sie also Lob verdient. Dass sie sich aber überhaupt an diesem Machwerk beteiligt hat, bleibt unverzeihlich.
Spätestens nach dem ersten Drittel verliert sich der Film in Variationen der immer gleichen Szenen. Diese Wiederholungen tragen jedoch nicht etwa dazu bei, die Einöde der Arktis greifbar zu machen, sondern begründen lediglich eine plumpe und eindimensionale Charakterentwicklung: Die kalte Weiße (hier ist nicht der Schnee gemeint) wird durch Begegnung mit der edlen aber einfältigen Wilden zum Guten bekehrt. Und langweilig ist das Ganze auch noch. Getoppt werden die ohnehin schwer erträglichen Leidensmomente durch die maßlos melodramatische Musik. Zum Kotzen.
Besonders perfide ist, dass der Film ausgerechnet im Abspann (den obligatorischen Was-wirklich-aus-den-Personen-geworden-ist-Texttafeln) noch versucht, sich einen Kolonialismus-kritischen Anstrich zu geben – nachdem er zwei Stunden wenig subtil verschiedenste Rassismen auf den Plan gerufen hat (auch der treuherzige Quotenschwarze ist mit von der Partie). Die letzte Hoffnung, dass der Film noch mit irgendeinem ernstzunehmenden cineastischen (oder wenigstens moralischen) Mehrwert aufwarten würde, ist zu diesem Zeitpunkt schon längst gestorben. Immerhin: Schlimmer kanns wohl nicht mehr kommen.
Fazit: Politisch katastrophal, filmkünstlerisch zermürbend – und damit gerade für die Berlinale einfach nur peinlich.
Sven und Costja
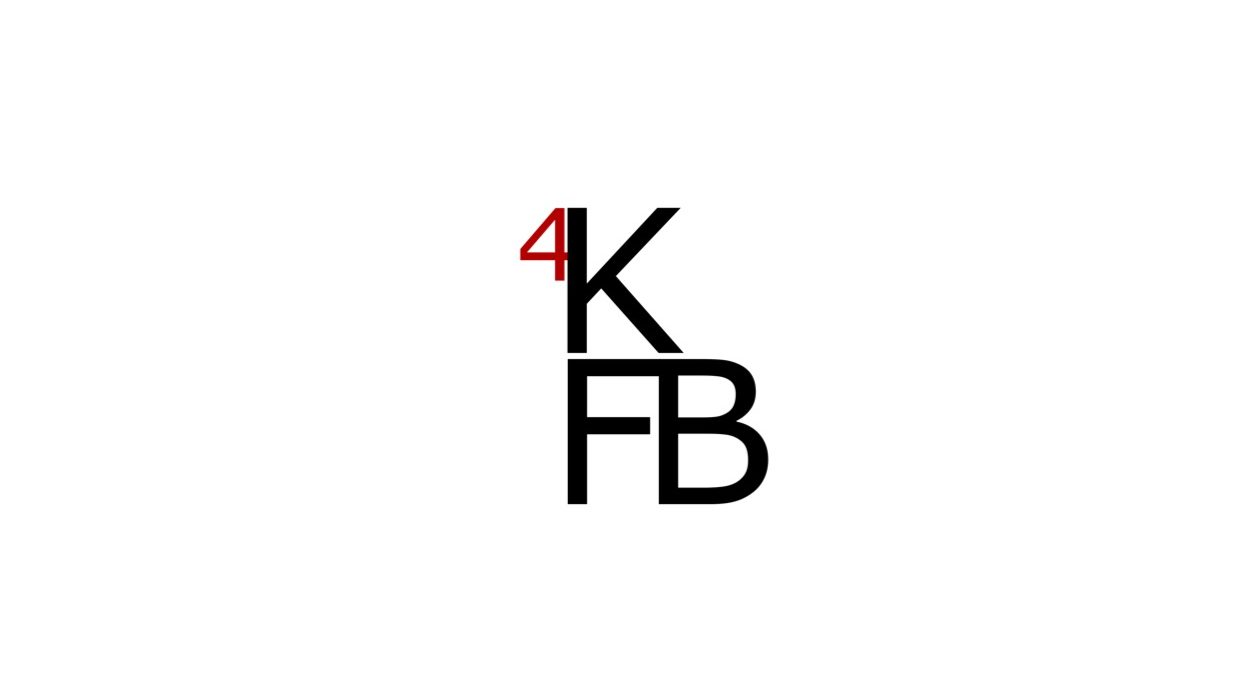

2 Kommentare