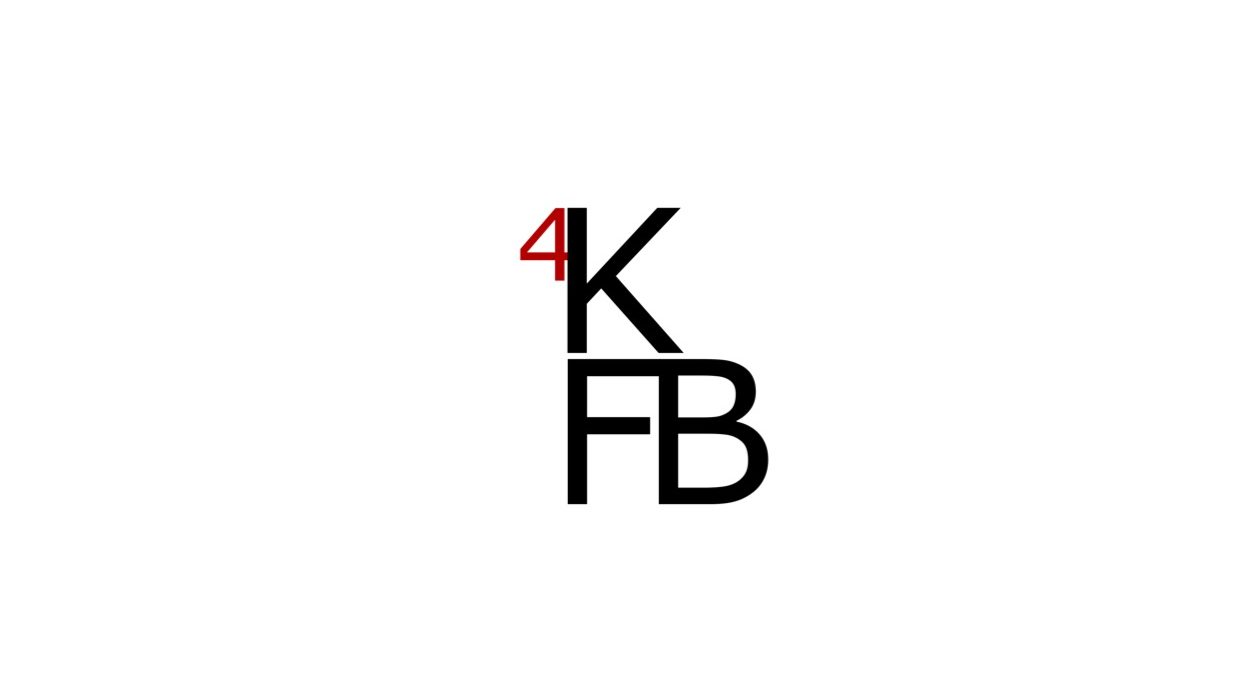Zwei Frauen kommen angeheitert von einer nächtlichen Party und machen sich einen Spaß daraus, auf der falschen Straßenseite zu fahren. Sie treffen einen Bekannten, man quatscht über Banales und Politisches, singt lauthals Klassiker aus dem Autoradio mit, und genießt rauchend die Aussicht über eine nächtliche Stadt.
Der Clou dabei: Diese Stadt ist Teheran, die Hauptstadt Irans – einem Land, aus dem sonst nur allerlei Schreckensmeldungen zu uns dringen. Und nun spielt hier ein Roadmovie über junge Leute, die gemeinsam eine gute Zeit haben? Der Film Atom Heart Mother von Ali Ahmadzade ist weit mehr als das: Er beginnt als ungewöhnlicher „Kifferfilm“ (Berlinale-Teaser), kippt dann aber kunstvoll schleichend ins Übersinnlich-Subversive. Das wird spätestens klar, als ein dämonisch charismatischer Fremder auftaucht, der sich nicht mehr abschütteln lässt, und die Grenzen des Realen zu verschwimmen beginnen…
Ästhetisch ist der Film geprägt von räumlicher Enge: Die Damentoilette, der Fahrstuhl, und vor allem der Innenraum des Autos, mit dem die beiden Protagonistinnen unterwegs sind, das sind die Orte, an denen sich das Geschehen zum überwiegenden Teil vollzieht und nur selten weitet sich die Perspektive, wenn die Figuren vorübergehend das Auto verlassen. Die Enge der Räume korrespondiert mit einer außerordentlichen Weite der Zeit: Es dominieren lange Einstellungen, wenige Schnitte und eine zumeist statische Kamera, die, ohne, dass Langeweile aufkäme, ein Gefühl der Zeit-losigkeit erzeugen und die träumerische Grundstimmung verstärken. Auch musikalisch ist der Film zurückgenommen: Er verzichtet weitgehend auf Filmmusik-typische Dramatisierungen (wie wir sie im Wettbewerb dieser Festspiele allzu häufig beklagen mussten) und verlässt sich stattdessen meist ganz auf die Kraft seiner Bilder.
Inhaltlich besteht die erste Überraschung für westliche Augen sicher in der relativen Freizügigkeit, die der Film zeigt – mitten in der Islamischen Republik. Ja, die beiden weiblichen Hauptfiguren tragen Kopftuch, allerdings wirkt das in Kombination mit ihren knalligen Frisuren, modischem Mantel und einer RayBan-Brille eher wie das stylistische Accessoire zum Cabriolet der 60er Jahre. Überhaupt unterscheiden sie sich in ihrem Ton und ihren Umgangsformen nicht wesentlich von jungen Frauen aus der Mittelschicht im westlichen Teil der Welt. Und tatsächlich nutzen wohl zumindest die jungen Leute der iranischen Hauptstadt in den letzten Jahren vermehrt die Grauzonen der politisch-religiösen Dogmatik zum langsamen Aufbau und Ausloten gewisser Freiräume. Ob der neckisch-rebellische Umgang mit iranischen Verkehrspolizisten, wie ihn der Film in einer Szene zeigt, im echten Iran möglich wäre, muss zwar vielleicht bezweifelt werden – schließlich liegt aber gerade in der fiktionalen Überschreitung realer Grenzen die große Macht des Kinos und es ist (unter anderem) die subtile Ausnutzung dieses subversiven cineastischen Potentials, das Atom Heart Mother so faszinierend macht.
Der Konflikt um das iranische Atomprogramm, zum Beispiel, wird von den Figuren des Films diskursiv aufgegriffen. Allerdings auf eine derart uneindeutige, mehrfach gebrochene Weise, dass man weder aus den direkten Äußerungen einzelner Charaktere noch aus dem Kontext dieser Aussagen ohne weiteres eine eindeutige Position des Films selbst schließen könnte. Ob zum Beispiel die Äußerung des männlichen Dritten über die Angemessenheit des iranischen Atommachtstrebens und die Notwendigkeit, zuerst zu bomben, eine ironische oder ernst gemeinte ist, ob der Filmemacher dem zustimmt oder nicht, bleibt offen und wird weder kommentiert noch bewertet – sondern bloß abgebildet.
Der Film ist kein offen politischer, zumindest deutlich weniger offen, als das zum Beispiel Taxi war. Der Film scheint nicht um eine Botschaft herum gebaut, nach denen sich Drehbuch und Inszenierung dann richten würden, um sie möglichst versteckt und doch deutlich rüber zu bringen. Eher ist er eine Mischung aus Tarantinoeskem Roadmovie (an einer Stelle pfeift eine der beiden Protagonistinnen dann auch tatsächlich die berühmte „Twisted-Nerve“-Tonfolge aus der Krankenhausszene in Kill Bill) und einem fantastischen Realismus à la Gabriel Garcia Marquez (auch der wird im Film erwähnt). Von ersterem inspiriert scheinen die ausgedehnt mäandernden Dialoge über Themen von Pink Floyd (siehe Filmtitel, der von einem gleichnamigen Album der Band herrührt) bis zur „Iranian Toilet“, von letzerem die Tendenz eine Realität aufzubauen und zu bewahren, die dann immer wieder von Einschüben des übersinnlich Irrealen durchdrungen wird.
Das macht der Film so konsequent, dass bis zum Ende unklar ist, ob der lakonisch-charismatische Fremde in Schwarz (hervorragend gespielt von Mohammad Reza Golzar), der wie aus dem Nichts irgendwann zu den beiden Frauen stößt, ein sadistischer Spinner oder doch der Leibhaftige selbst ist. Verstärkt wird diese Doppelbödigkeit noch durch die vorangestellte Rahmung der Filmhandlung als Traum eines anonym bleibenden Subjekts (ist es der Regisseur, eine der beiden Frauen oder die teuflische Männerfigur des Films? Immerhin sagt sie uns: „You don’t know who I am and you will never find out“). Überhaupt wird im Film selbst (als Traumgeschehen) immer wieder auf verschiedene Träume verwiesen: Etwa der des Bekannten der beiden Frauen, der von einem Atombombenabwurf über Teheran träumte – dessen Hitzewelle ihm dann immerhin das dringend benötigte Feuer liefert, um seine Zigarette zu entzünden. Eine der beiden Frauen (eine Doktorin der Psychologie) deutet dieses Szenario als gutes Omen: „Everyone will be fine“ – immerhin habe er am Ende seine Zigarette anbekommen.
Die Teufelsfigur als Medium der soziokulturellen wie politischen Subversion hat natürlich eine lange Tradition (im Iran etwa ist sie schon seit einigen Jahren zum rebellischen Symbol der hiesigen Hardrocker geworden). Sie ist „der Geist, der stets verneint“: Was man ihr in den Mund legt, ist in seiner Bedeutung immer schon uneigentlich und so scheint sie prädestiniert zur Meinungsäußerung in politisch brisantem Umfeld (man denke an Michail Bulgakov, der mit seinem „Meister und Margarita“ im Kontext des stalinistischen Russlands in dieser Hinsicht Maßstäbe gesetzt hat). Was der Teufel sagt, ist einerseits moralisch diskreditiert. Er kann anprangern, was der Autor selbst nicht ansprechen darf: Dieser kann sich dann gegen alle Vorwürfe der politischen Aufrührerschaft hinter die Teufelsgestalt zurückziehen und sich damit verteidigen, dass es sich um einen diabolischen Verführungsversuch handele und nicht etwa seine eigene Meinung. Der Autor kann sich aber auch das Negativ-Image des Teufels zu Nutze machen, indem er ihn nur gerade so erkennbar macht und dann gerade diejenige Position vertreten lässt, die er selbst verurteilen oder deren Unrechtmäßigkeit er satirisch demonstrieren will – im Zweifelsfall ist es dann gar nicht der Satan. Die Wandlungsfähigkeit des Teufels machts möglich…
Ahmadzade spielt mit diesen Varianten auf virtuose Weise: Beispielsweise ist die eine der beiden Hauptfiguren Christin und (wohlgemerkt aus familiären Gründen) kurz davor, das Land Richtung Vatikan zu verlassen. Auch ihr männlicher Bekannter offenbart ganz unbedarft den Plan, nach Australien auszuwandern (nachdem er sich zuvor – wohl reichlich ironisch – zum Verteidiger des iranischen Nationalstolzes aufgeschwungen hat, indem er die ‚westliche Toilette‘ auf eine iranische Erfindung zurückführt). Ausgerechnet der Fremde mit den teuflischen Zügen ist es dann, der mehrfach sein Unverständnis darüber äußert, dem Iran den Rücken kehren zu wollen, der doch so unvergleichlich viele Freiheiten biete. Dieser Fremde ist es auch, der einerseits in höchsten Tönen von Bashar Al-Assad (Verbündeter Teherans) schwärmt und die Zerstörungswut amerikanischer Interventionen verurteilt, sich zugleich aber als Freund Saddam Husseins zu erkennen gibt (der in den 1980er Jahren einen blutigen Krieg gegen den Iran führte) und offensichtlich mit den Amerikanern kooperiert.
So jongliert der Film mit spielerischer Leichtigkeit quasi nebenbei politische Aufreger, ohne dabei seinen filmkünstlerischen Anspruch aufzugeben. Spannend wäre es sicherlich, einmal die Interpretation eines Exil-Iraners (von denen zahlreiche bei der Premiere anwesend waren) zu hören, oder zumindest von jemandem, der mit den Einzelheiten iranischer Politik- und Alltagskultur besser vertraut ist. Doch auch jenseits allen Politischen, jenseits des iranischen Kontexts hat Ali Ahmadzade ein ästhetisch anspruchsvolles, surreales, spannendes Filmkunstwerk gezaubert. Man kann ihm nur wünschen, dass die teuflische Subversion verfängt und er es auch in seinem Heimatland wird zeigen dürfen.
Costja
(Bildmaterial: Berlinale Filmstill, Sektion: Forum)