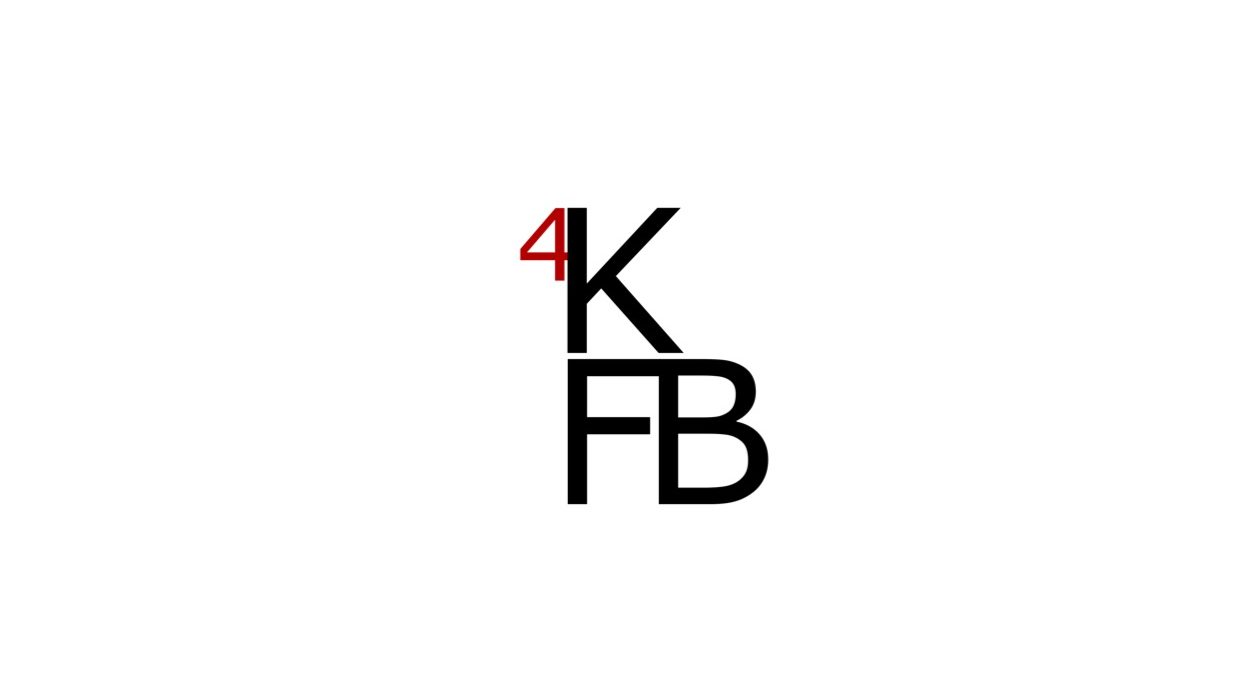Der japanische Regisseur und Berlinale-Dauergast Sabu ist bekannt dafür in seinen Filmen erfolgreich Komik und Tragik zu mischen. Trotzdem geht in seinem Wettbewerbsbeitrag „Mr.Long“ das Rezept nicht wirklich auf. Selbst wenn es um einen Profikiller geht, der grandios gut kochen kann.
Der Taiwanesische Auftragskiller Long vermasselt einen Auftrag in Tokio, kann aber verwundet vor den rachedurstigen Gangstern fliehen. In einem heruntergekommenen Industriegebiet bricht er schließlich zusammen. Dort wird er von dem achtjährigen Jun gefunden, der ihn mit dem Nötigsten versorgt, bis er sich notdürftig in einem der verlassenen Häuser einrichten kann. Bald entdeckt Long, dass Juns Mutter Lily drogensüchtig ist und setzt sie gegen ihren Willen auf Entzug. Die beiden versorgt er mit einem einfachen, aber leckeren Eintopf. Schnell entdeckt auch eine Freundesgruppe aus der Nachbarschaft die Kochkünste des schweigsamen Long und nimmt ihn als neues Projekt auf. Das geht sogar soweit, dass sie seine Unterkunft aufpolieren und ihm einen Stand besorgen an dem er Nudelsuppe verkaufen kann. Während Long so die Tage zählt bis er nach Taiwan zurückkehren kann, bildet er mit dem kleinen Jun und später auch mit der ausgenüchterten Lily so etwas wie eine provisorische Familie. Doch bald, wie kann es anders sein, holt ihn die Vergangenheit wieder ein.
Schon zu Beginn merkt man mit welchen Qualitäten hier gearbeitet wird. Bilder von Hong Kong bei Nacht – der Blick geht nach oben entlang leuchtender Fassaden – gehen nahtlos über zu einer Gangsterrunde in einem Lagerhauskeller. Einer in der Runde wird vermisst, die Beute schon neu aufgeteilt, da erscheint der Gesuchte, kippt aber tödlich verwundet nach vorne und macht den Weg für Long frei, der sich in einigen Sekunden mit dem Kurzschwert durch die Gangsterrunde durchmetzelt. Daran ist vor allem der ausgezeichnete Rythmus bemerkenswert, der fast den ganzen Film durchzieht und die disparaten Elemente verbindet.
Das gilt auch für eine herrliche Szene mit der Nachbarschaft, die für den Großteil der Lacher des Films verantwortlich ist. Darin beschließt die Freundesgruppe Long auszuhelfen und mit ihm den Nudelstand zu eröffnen. Mit bewundernswertem Timing steigert sich die Gruppe mehr und mehr in ihre Idee hinein, während Long daneben sitzt und kein einziges Wort versteht. Am Ende zieht er mit einem vollbeladenen Karren an „abgelegten“ Sachen davon.
Mit dem kleinen Jun bildet der schweigsame Long von Anfang an ein unwahrscheinliches Duo. Beide scheinen gleichermaßen einsam: Long der ohne Pass im fremden Land gestrandet ist und Jun, der anscheinend nicht zur Schule geht. Ohne viel Worte zu wechseln, hilft Jun dem fremden Mann weiter, begleitet ihn später zur Arbeit an den Nudelstand. Manchmal essen sie zusammen Eis, von der Kamera vorsichtig aus der Ferne beobachtet. Wenn Long am Abend Nudelteig mit den Füßen stampft, richtet sich sein Blick auf den Kalender mit dem er die Tage zu seiner Abreise zählt.
Dass die drei hier skizzierten Szenen in einem einzigen Film zusammenkommen ist das Außergewöhnliche an den Arbeiten des Regisseurs. Die Übergänge und Stimmungen sind an vielen Stellen wunderbar ausgeführt und lassen mein Herz höher schlagen. Aber eben leider nicht immer.
Vor allem Lily, die drogensüchtige Mutter des kleinen Jun, ist als Figur so wenig originell, dass selbst die gut zwanzig Minuten lange Rückblende in der Mitte des Films nichts mehr hinzufügen kann. Im Gegenteil macht sie die Sache eher nur noch schlimmer. Dort sieht man wie Lily, die wie die Hauptfigur eigentlich aus Taiwan stammt, im Nachtleben Tokios als Escorte arbeitet. Dabei kommt sie ihrem Kollegen näher, die beiden verlieben sich ineinander, wollen heiraten. Dann wird sie überraschend schwanger. Als er sie gerade mit dem Heiratsantrag überraschen will, lauern schon die gemeinsamen Arbeitgeber in der Wohnung um diese „Schädigung der Ware“ zu rächen. Die ersten paar Minuten dieser Rückblende (ein erstes gemeinsames Abendessen und ein langer Kuss auf der Straße) hätten vollkommen ausgereicht um klar zu machen was passiert ist. Alles danach wirkt – bis auf die brutale Ermordung ihres Geliebten durch die „Arbeitgeber“ – kitschig und plakativ. Getroffen von diesem Verlust und mit ihrem kleinen Sohn beginnt Lily nun als Prostituierte zu arbeiten und rutscht durch einen ihrer Freier in die Drogensucht.
Diese Backgroundstory könnte quantitativ locker ein eigenes Drehbuch hergeben, wird aber schnell und hastig durchexerziert. Dass dieser Exkurs nicht nach und nach in die Hauptgeschichte eingewoben ist, macht das sowieso anfällige Klischee der schönen, aber drogenabhängigen Prostituierten billiger als es eigentlich sein müsste. Wirklich schade, schließlich hat man als Zuschauer auch großen Spaß an dem schweigsamen Killer Long mit dem weichen Herz. Vieles an Klischees ist verzeihbar, wenn es gut und glaubwürdig erzählt wird. Gerade im Vergleich mit dem stoischen Mr.Long wird das tragische Potenzial dieser Frauenfigur aber geradezu ausgeschlachtet, ist zu mechanisch angelegt und reißt ein Loch in einen Film, der sonst von großer Komik, Gewandtheit und einem tollen Rythmusgefühl geprägt ist. Würde ich „Mr.Long“ nochmal anschauen? Ja, aber dann mit einem langen Nickerchen in der Mitte des Films.