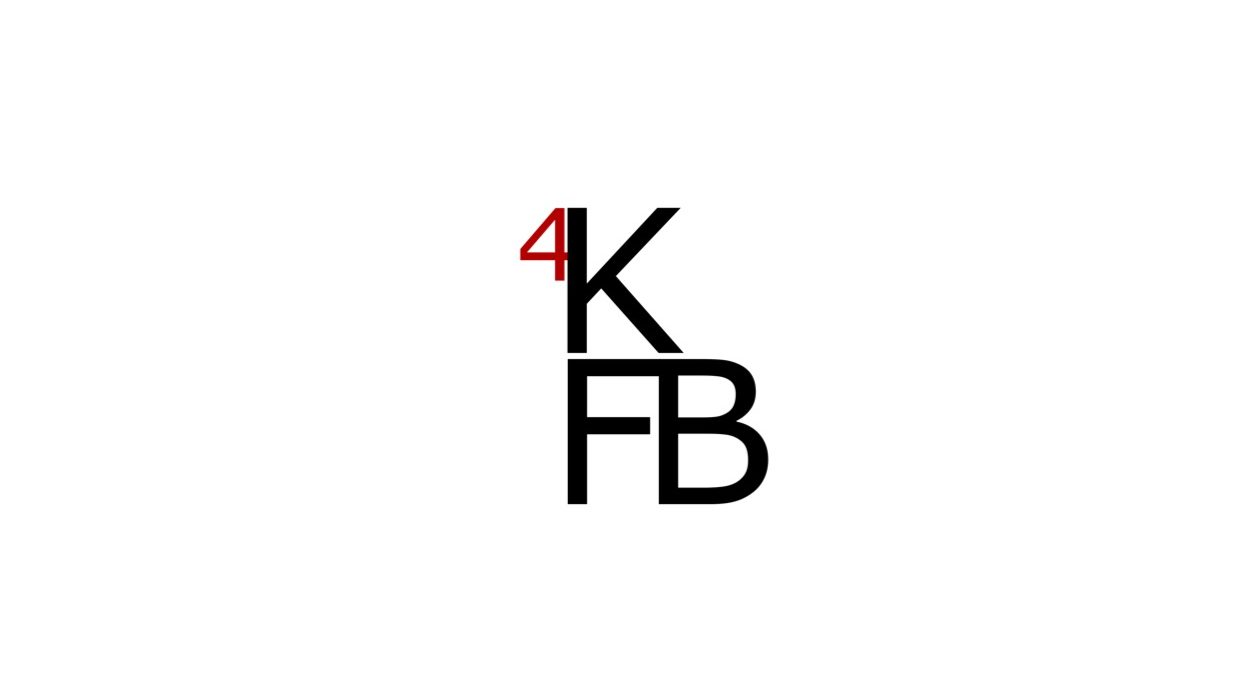Dieser Film lässt sich Zeit, viel Zeit. Und das völlig zu recht, denn er begleitet zwei Kolonialbeamte dabei, wie sie sich ein langes Jahr auf einem Handelsposten im Kongo vertreiben – im Wesentlichen mit Trinken, Rauchen und ziellosen Spaziergängen. Ihnen dabei zuzuschauen ist hingegen keineswegs langweilig: Hugo Vieira da Silvas Posto avançado do progresso (An Outpost of Progress) entwickelt in betörenden Bildern und mit subtiler Komik das Panorama weißer Überlegenheitsphantasmen gegenüber dem ‚wilden Kontinent‘ – und führt sie genüsslich, in betörender Optik ad absurdum.
In den ersten Minuten fühlt man sich beinahe geblendet vom merkwürdigen Licht dieses Films, in seiner gleißenden Ruhe am Rande der Sinnestäuschung, gespiegelt in den weißen Uniformen der beiden portugiesischen Offiziellen. Zugleich schlagen einen diese Bilder, schlägt einen dieses Licht unmittelbar in seinen Bann. Später wird ein Einheimischer davon erzählen, wie die kongolesische Bevölkerung die eintreffenden Weißen (in Analogie zu einem lokalen Mythos) für wiederkehrende Geister aus dem Totenreich hielt. Diese Gespenstigkeit, dieses Geisterhafte geht auch von den beiden Protagonisten aus: Nicht nur wegen der sie umgebenden Aura weißen Lichts, sondern vor allem weil sie, ganz wie lebende Tote permanent deplatziert wirken, nicht hinzugehörig.
Das Geister-Motiv durchzieht überhaupt den ganzen Film: etwa auch, wenn mit Fortgang des Films und des Lagerkollers einer der Portugiesen selbst Geister zu sehen beginnt; und schließlich in Form des einmal auf den Plan gerufenen Profitstrebens, das sich alsbald verselbständigt und eine blutige Eigendynamik entfaltet (deren Konsequenzen bis heute in den heutigen Konflikten des afrikanischen Kontinents nachhallen).
Im Zuge der repetitiven Abfolge von lethargischem Schlendern, endlosen Zigarettenlängen und sporadischen Unterhaltungen kommt es langsam zu kleinen Annäherungen zwischen den Offiziellen und den für die Elfenbeinbeschaffung angestellten kongolesischen Arbeitern – schließlich sind sie zwar ‚unwissend, aber trotzdem Menschen‘, wie der ranghöhere Beamte am Anfang in gönnerhafter Manier mit Blick auf die mögliche ‚Zivilisierung‘ des Kongos noch verlauten lässt : Man trinkt und lacht zusammen, tanzt (torkelt) gar gemeinsam zu den Klängen des mitgebrachten Grammophon; nachdem man ihnen eben noch nicht mal die Mittagspause gegönnt hat – und sie daraufhin, in einem Ausbruch ungeduldigen Tatendrangs, wieder unwirsch zur Arbeit hetzen lässt. Denn auch diese ‚Arbeit‘ der Arbeiterschikanierung obliegt dem kongolesischen Vorarbeiter. Die beiden Europäer bleiben ahnungs-, hilf- und tatenlos gegenüber der bedrohlichen Andersartigkeit Afrikas. Ihre einzige Regung besteht in misstrauischem Abscheu und der gequälten Frage, wie man bloß endlich an Elfenbein komme. Zurückgelehnt versichern sie sich ihrer eigenen ‚zivilisierten‘ Überlegenheit gegenüber den trommelnden ‚Wilden‘; wobei sie durchaus Wert darauf legen, den Sklavenhandel hinter sich gelassen zu haben. Wie der Film diese scheinheilige Selbstüberschätzung ganz beiläufig konterkariert, indem er sie in einen entlarvenden Kontrast zur ignoranten Bräsigkeit und fortschreitenden Verwahrlosung der beiden Beamten setzt, ist nicht nur genugtuend, sondern auch immer wieder überraschend unterhaltsam.
Was freilich nicht heißt, dass es dem Film an Ernsthaftigkeit oder Dramatik ermangeln würde. Er nimmt die Tragweite seines Themas keineswegs auf die leichte Schulter. Besonders in der zweiten Hälfte wird deutlich, wie sich die importierte Gier nach Rohstoffen verselbständigt und in ihrer erbarmungslosen Logik jedes humanitäre/humanistische Lippen-Bekenntnis der portugiesischen Beamten unterläuft – trotz, oder gerade wegen der vornehmen Zurückhaltung (naive Fortschrittsgläubigkeit) der Protagonisten, die glauben, mit sauberen Händen bzw. reinem Gewissen Profit machen zu können (während ihre Uniformen schon nach wenigen Wochen ihre Sauberkeit eingebüßt haben – und die beiden Beamten ihre diesbezügliche Sorgfalt). Selbst hier macht sich schließlich ein Einheimischer die Hände für sie schmutzig.
In dem Maße, in dem sich das Jahr des Aufenthaltes in die Länge zieht, mag einem auch der Film stellenweise etwas lang werden. Aber es lohnt sich, darüber hinwegzusehen. Denn im letzten Drittel überrascht er dann nochmal mit einer völligen Ton- und Stiländerung. Hier verdichtet sich etwa die schon latent angelegte Stummfilmcharakteristik der beiden Hauptfiguren filmästhetisch untermauert zu einer grotesken Version von Laurel und Hardy.
Am Ende bleiben sie, zerrissen zwischen Abscheu, Unverständnis und Genugtuung, allein mit ihrem (nun reichlich vorhandenen) Elfenbein – aber mit zur Neige gehenden Vorräten und schwindender Gesundheit. Und erneut zeigt sich, wie verloren und fehl am Platz diese beiden europäischen Gespenster sich hier gebärden – beziehungsweise der von ihnen repräsentierte Herrschaftsanspruch -, wie uneinsichtig und hilflos gegenüber ihrer Umgebung; und wie sie an diesen offenbaren Widersprüchen schließlich mit lakonischer Notwendigkeit zugrunde gehen müssen.
Fazit: Ein kluger, politischer, und doch immer wieder komischer Film in brillanten Bildern – kurz, großes Kino im besten Sinne.
Constantin