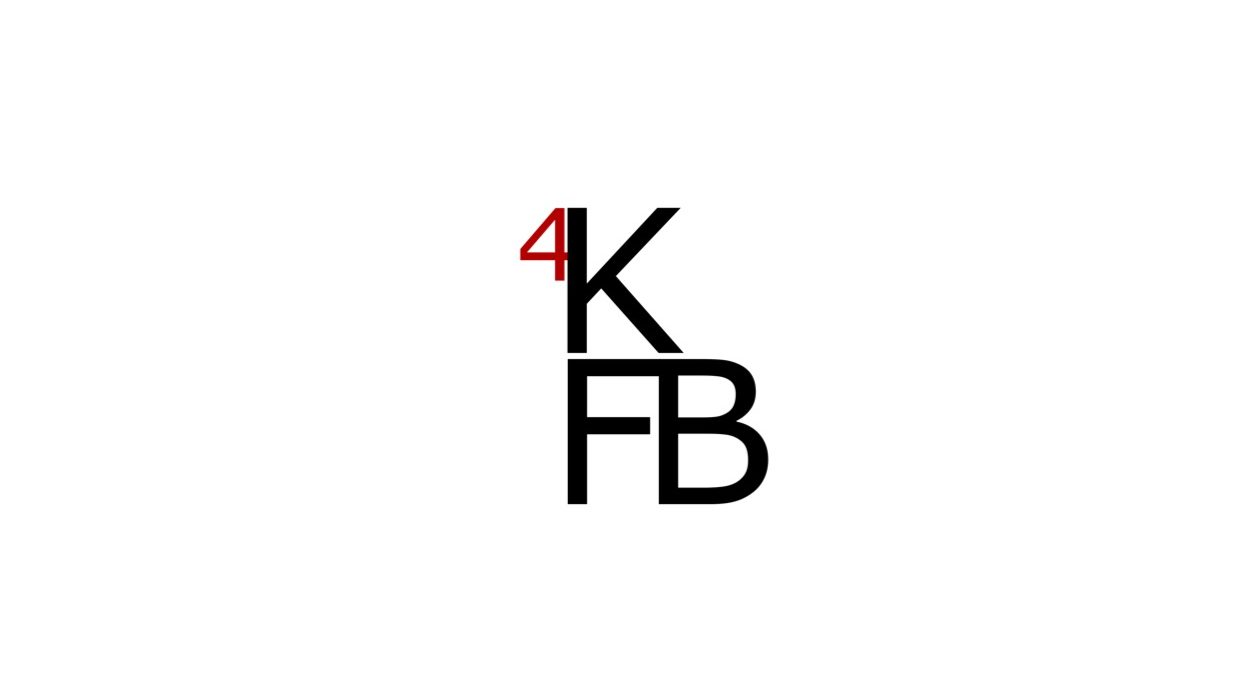Hasans (Hasan Majuni) Arbeit wird nicht geschätzt: Nicht von seiner Muse, die mit einem anderen Regisseur drehen möchte, nicht von den iranischen Behörden, die ihn seit Jahren keine Filme machen lassen, und nicht von der Werbebranche, für die er nun Spots drehen muss,um sich über Wasser zu halten. Und scheinbar respektiert ihn nicht einmal der Serienkiller, der in Teheran einen Filmemacher nach dem anderen umbringt und nur ihre mit „Khook (Schwein)“-Einritzungen verzierten Köpfe zurücklässt. Der verschont ihn nämlich und ruiniert damit dessen Ruf – meint zumindest Hasan selbst, als er sich bei seiner Mama über all die Ungerechtigkeiten ausheult, die ihm widerfahren. Die weiß, wie sie ihren Sohn aufbauen kann: „Keine Sorge, mein Schatzi, der Killer kommt schon noch zu dir – er hebt sich den Besten eben für den Schluss auf!“
Dieser tiefschwarze Sarkasmus zieht sich durch den Großteil von Khook, dem neuesten Film von Mani Haghighi, der im Film übrigens selbst ebenfalls dran glauben muss. So schwarz sein Humor, so verspielt seine Bildsprache und Inszenierung: Die selbstmitleidige Reise Hasans, der sich von knallbunten Kostümparties in den Knast zu den sozialen Medien jammert, ist so überdreht, farbenfroh und ausschweifend, als sei sie einer pilzinduzierten Orgie zwischen Glitzer-Musikvideos der 80er, sämtlichen verrückten Studentenfilmen der Welt und einem von Alejandro Yodorowsky ausgemalten Mandala entsprungen. Auf 10 Sekunden heruntergeschnittene Tennismatches, hübsche Frauen in einem Kakerlaken-Musical, Gitarrenriffs von ACDC, die auf einem Tennisschläger gespielt werden. Dabei legt Haghighi eine erstaunliche Kompromisslosigkeit an den Tag und schreckt weder vor übelstem Kitsch noch vor comichaftem Splatter zurück. Das klingt auf dem Papier alles furchtbar drüber und unzugänglich – lässt sich aber durchaus genießen. Die Infantilität seiner Charaktere legt ja ohnehin einen kindischen Film nahe, und dazu passt auch der überbordende Stil Haghighis ausgezeichnet. Khook ist gewissermaßen wie eine neonlila Flamme: sehr eigenartig, nach allen Seiten ausgreifend, und eigentlich ohne einen großen Nutzen. Aber eben auch geil anzuschauen, wenn man auf abgedrehtes Kino steht.
Schlussendlich lässt sich dem Film auch noch eine politische Note abringen. Schließlich handelt es sich um einen iranischen Film, und die werden gerade im Westen ja stets auf ihre Subversivität geprüft. Einerseits ließe sich Khook als Eskapismus lesen, der sich zugunsten einer ästhetischen Erfahrung entpolitisiert. Bedenkt man aber, dass der namenlose Killer die Filmindustrie gerade aufgrund ihrer vermeintlichen Sündhaftigkeit „reinigen“ will, so tut der prinzipiell nichts anderes als der iranische Staat: Durch seine Hand sterben die Regisseure lediglich einen physischen Tod, anstatt des sozialen und künstlerischen Todes, von dem sie momentan bedroht sind. Die Tatsache, dass Hasan durch die Morde erst wieder Aufmerksamkeit bekommt und gewissermaßen Nutznießer dieser Grausamkeiten ist, lässt sich auf Haghighi übertragen, der einerseits noch drehen darf und damit sozusagen vom Killer verschont bleibt, dessen Filme aber zugleich auch wegen der repressiven Situation im Iran international höhere Wellen schlagen. In dieser Lesart scheint der wehleidige Hasan eher wie eine bittere Auseinandersetzung mit sich selbst und seiner eigenen Rolle im iranischen Regime, als eine bloße Parodie auf die unter Berufsverbot stehenden Regisseure wie Jafar Panahi.
Sven
Bildmaterial: Berlinale Filmstills; Wettbewerb