Der Regisseur sei selbst Kurator und habe einmal in Berlin gelebt. Diese Informationen erhielten wir vorab von Seiten des Kinos und sie sollten wohl für die Authentitzität des Folgenden bürgen. Überzeugender wurde das dadurch leider nicht: Elixir von Brodie Higgs erzählt von einer fiktiven Berliner WG (dem ‚Glashaus‘) aus leidenden Künstler-Rebellen – dargestellt in einer Mischung aus Bohémiens der vorletzten Jahrhundertwende und Eso-Hippstern der Gegenwart – , in ihrer Auseinandersetzung mit der kommerzialisierten Kunst („Fashion“, Berlin Art Week), Grundsteuern und dem Establishment im Allgemeinen. Könnte ein vielversprechendes Sujet abgeben – leider aber erfolgt die Darstellung dieser Szene und ihrer Konflikte auf so furchtbar prätentiöse, stereotype Weise, und mitunter so unreflektiert, dass der Film das Potential des Themas ebenso verschenkt wie seine handwerkliche Rafinesse.
Das Problem beginnt mit den Figuren des Films: Sie sind eine eigenartige Mischung aus historischen, aber stereotyp inszenierten Künstlerfiguren (André Breton, Tristan Tzara, u.A.) und den Problemen und Charakteren einer gegenwärtigen Berliner Kunstszene – eine Mischung, die leider nicht aufgeht: Für eine surreale Konfrontation (wie Regenschirm und [Hummer?] auf dem Nähtisch) geht der Film mit dieser seiner Konzeption zu realistisch um, zu wenig absurd. Für eine ernsthafte und aktuelle Auseinandersetzung mit Fragen der Kunst, der Kommerzialisierung, Gentrifizierung, einem sich verlierenden Freiheitsgeist Berlins oder einfach der Poesie (all das sind Themen, die der Film in irgendeiner Weise anschneidet), ist die Darstellung wiederum zu unglaubwürdig, zu eindimensional. Zumal das Drehbuch die Komplexität des Kunstbetriebs auf die Konfrontation (den „Krieg“) einer widerständigen Künstler-WG gegen den profitgierigen Art-Boss reduziert (wobei natürlich Verrat im Spiel ist). Ebenso abgegriffen der Kampf zweier Männer um eine passiv-stumme Frau oder die (der Filmhandlung vorangehende) Entzweiung dieser beiden über den Drogentod eines gemeinsamen Freundes.
Die abgehobene Selbstbezogenheit der Figuren wird besonders deutlich, als die Hauptfigur André sich über die Einforderung der Grundsteuern durch die Stadt echauffiert und zum Protest vor dem Rathaus aufruft, überzeugt, dass der Erhalt des vom Vater geerbten ‚Glashauses‘ für den Rest der Bevölkerung genauso bedeutend sein müsse wie für ihn selbst. Statt aber diese Haltung zu hinterfragen, ironisch zu brechen oder wenigstens für sich stehen zu lassen, dient sie dem Film als Ressource einer verklärenden Dramatisierung des Künstlerleidens an Kunstkommerz und Den Umtrieben des Ordnungsamts.
Trotz des überzeugenden Spiels des André-Darstellers, kann auch das Spiel der meisten Mitwirkenden kaum überzeugen. Besonders der leidvolle Ausdruck der weiblichen Protagonistin (einer ‚mysteriösen Fremden‘) bleibt fast immer der gleiche, wird zur stereotypen Charaktermaske – eben ohne die subtile Ausdruckskraft der Hauptdarstellerin aus Until I lose my Breath etwa. Ihre vom Film als achso poetisch inszenierten Ergüsse sind tatsächlich ausgewaschene Plattittüden („You are the most complicated and most beautiful problem in the world.“) – allerdings spielt ihr Inhalt spielt letzten Endes ohnehin keine Rolle.
Diese inhaltliche Banalität des Films ist bedauerlich. Denn seine Bildsprache, der Schnitt, überhaupt die Erzählweise können in ihrer explikatorischen Selbstbeschränkung anfangs durchaus für sich einnehmen. Später freilich verliert der Film auch in dieser Hinsicht und unterlegt die ins Süßlich-Kitschige kippende Handlung mit zeitgenössischen Tracks des pathetischen Herzschmerzes. Trotz einiger schöner Ideen, manch gelungener schauspielerischer Darbietung (und obwohl der Film den Berlin-Mythos zunächst nicht allzu offenkundig strapaziert), ist man schnell gelangweilt und nach spätestens einer Stunde nur noch genervt – wenn man den Saal zu diesem Zeitpunkt nicht schon längst verlassen hat.
(Bildmaterial: Berlinale Filmstill, Sektion: Perspektive deutsches Kino)
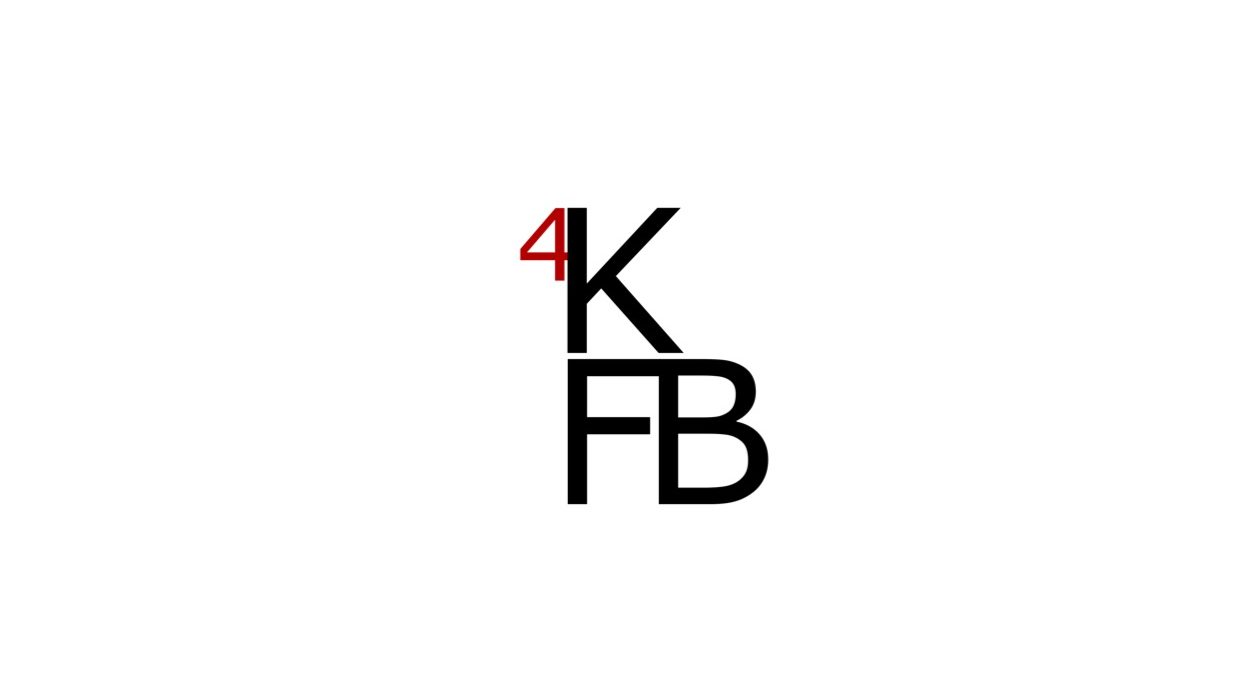

1 Kommentar