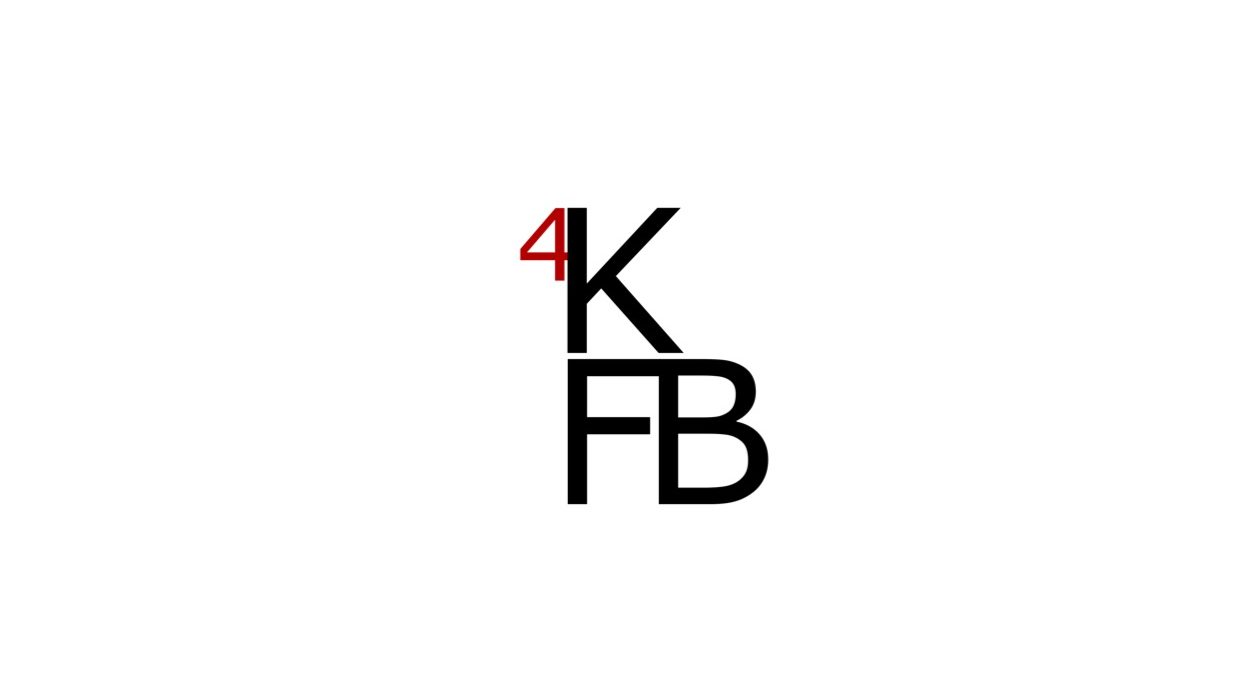Noch ein großer Name, der enttäuscht bei dieser Berlinale: Ausgerechnet Andreas Dresen, der mit Sommer vorm Balkon oder Wolke 9 so wunderbar einfühlsame, unkonventionelle Filme schuf, hat mit seinem neuesten Werk das glatte Gegenteil erreicht: Als wir träumten, nach dem gleichnamigen Roman von Clemens Meyer ist eine end- und einfallslose Aneinanderreihung immer gleicher Szenen, von pseudowilden Saufgelagen, stereotypen Feierszenen, Verfolgungsjagden durch die bösen Kleinstadtnazis und darauf folgenden Schlägereien. Wer da eigentlich träumt (jenseits der langweiligen Abziehbild-Charaktere) und vor allem wovon da geträumt wird (außer einer diffusen ‚Größe‘) bleibt völlig unklar – Hauptsache, große Gefühle. Und wenn Drehbuch und Darsteller die nicht alleine wecken können, dann wird das Publikum halt einfach weggebasst, bis es vergisst, was für weichgespülte Konventionen es da vorgesetzt bekommt… Der ‚große Name‘ scheint auch Andreas Dresen (bzw. seiner Filmkunst) nicht bekommen zu sein.
Als wir träumten wirkt, als habe sich ein begeisterter Leser der Buchvorlage (Dresen selbst oder Drehbuchautor Wolfgang Kohlhaase) seine Lieblingsstellen herausgesucht und dafür dann eins zu eins filmische Illustrationen gesucht. Der Film gebärdet sich wie ein kleines Kind, das ein bisschen übermotiviert sein Wochenende bei Oma und Opa nacherzählt und dabei, ohne Rücksicht auf Kohärenz oder Redundanz alles berichtet, was ihm gerade in den Sinn kommt: ‚Und dann waren wir Eis essen; und dann im Zoo; und dann nochmal Eis essen…‘ Die inszenatorische Einfallslosigkeit geht so weit, dass sogar die Kapitelüberschriften (in Form bildschirmfüllender, bunt-effekthascherischer Zwischentitel) übernommen wurden – als ebenso bemühte Neunziger-Referenz wie Musik und Partyszenen. Insgesamt wirkt der Film wie der zwanghafte Versuch, ein bestimmtes Zeitkolorit einzufangen (in dieser Hinsicht ähnlich wie, aber schlechter als Boyhood), das jedoch – man möchte meinen, durch den glättenden Filter der beteiligten Produktionsfirmen – verfälscht und dem Zeitgeist angepasst wird. Damit steht Als wir träumten im krassen Gegensatz zur liebevollen Rohheit von Dresens früheren Filmen – was wir hier zu sehen bekommen, sind bloß lauter Katalogbilder. Ganz zu schweigen vom latenten Sexismus, der in einigen Szenen mitschwingt…
Über zwei Stunden fragt man sich nach dem Ziel, dem Daseinsgrund dieses Films: Es gibt kein wirklich einleitendes Problem, sondern nur einen sich an seine Nachwende-Jugendzeit in Leipzig erinnernden Protagonisten, dessen Hintergrund und Motivation weitestgehend im Dunkeln bleiben; immerhin erfahren wir zweimal überdeutlich konstruiert aus dem Munde der alten Lehrerin Daniels, er habe doch „immer Reporter werden“ wollen – so als genüge das, um der Figur so etwas wie Charakterliche Tiefe zu verleihen. Warum er das mal wollte und warum nun nicht mehr, oder doch, oder welche Träume er hat, all das bleibt nicht nur unbeantwortet, der Film stellt diese Fragen gar nicht erst. Dafür nimmt er sich viel Raum, um neben den Szenen pseudorevolutionärer Adoleszenz eigenartig idealisierte Bilder der Grundschulzeit in den späten letzten DDR-Jahren zu zeichnen. Das volle Ausmaß ihrer Peinlichkeit erreichen diese Bilder aber gar nicht durch ihre Hochglanzoptik, sondern die ausnahmslos und unerträglich verständnisvoll gezeichneten Charaktere, vom Schulleiter bis zur Klassenlehrerin. Nun wäre ja die Verklärung der Vergangenheit ein durchaus interessantes Thema – leider bleibt sie in diesem Film jedoch völlig unreflektiert und dient als bloßes Mittel zur Erzeugung rosiger Rührigkeit.
Als Roman mag das Konzept durchaus aufgehen (wir haben ihn nicht gelesen und können deshalb nur Vermutungen anstellen): Diese Form bietet mehr Raum, um auf eine solche Vielzahl von Charakteren einzugehen und sie zu entwickeln, wie sie allein der Protagonist und seine vier Freunde bieten. Dieser Film hingegen verliert sich zwischen seinen Figuren, ohne dass irgendeine von ihnen über bloße Plattitüden hinauswüchse. Sie bleiben einem alle merkwürdig fremd, sogar gleichgültig. Die bemühte Dramatik des Films, durch Darstellung wie Dialoge, macht da alles nur noch schlimmer. Apropos Dialoge: Man kann im Sinne des Romanautors nur hoffen, dass zumindest diese auf dem Mist des Drehbuchs gewachsen sind. Aber vielleicht wirken sie auch einfach in der literarischen Vorlage schon deshalb besser, weil man sie da nicht durch überartikulierende, bemüht emotionale Darsteller serviert bekommt – deren mitunter seltsam theatrales Spiel sich mit dem realistischen Anspruch des Films beißt. Die euphorische Eskalation der Figuren wirkt immer ein bisschen zu gewollt und irgendwie ratlos.
Mit dieser Sinnleere aber geht der Film nicht um, sondern setzt die Partyrandale als bloßes Faszinosum, als conditio humana der Adoleszenz – nach dem Motto: Die sind jung. Da macht man das so. In all ihrer forcierten Wildheit wirken Figuren wie Film so letztlich merkwürdig bieder.
Ob nun aus Eigeninitiative oder auf Wunsch der verantwortlichen Redakteure – der neueste Dresen-Film wirkt auf unangenehme Weise bemüht, sich an ein ‚großes Publikum‘ anzubiedern. Dass man dieses ‚große Publikum‘ damit gewinnen kann (die Marketing-Kampagne gibt sich jedenfalls alle Mühe), ist fraglich. Sicher aber scheint, dass Dresen auf diese Weise sein angestammtes Publikum verlieren wird.