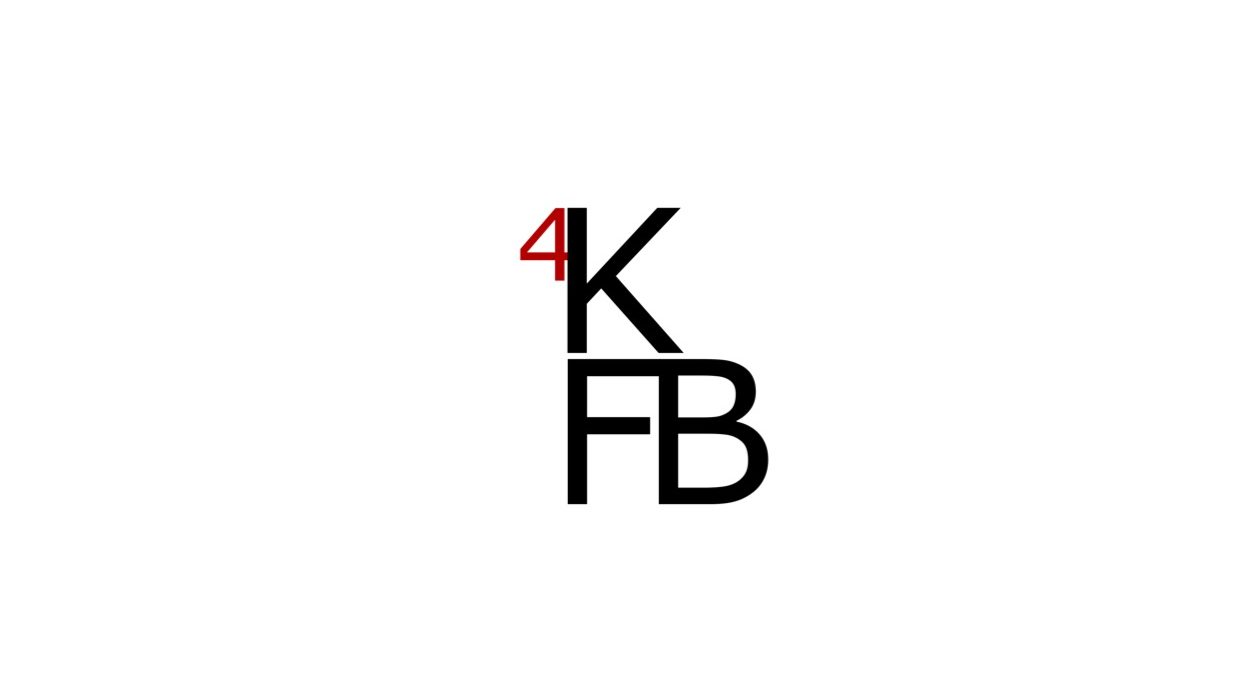Dies sei „kein Film über indigene Kultur, sondern wurde aus ihr heraus entwickelt“, informiert uns der Teaser-Text über Ixcanul. Und ausnahmsweise trifft der Teaser damit ziemlich gut die herausragende Qualität dieses Films: Dem fast dokumentarisch anmutenden und völlig ohne Musik auskommenden Wettbewerbsbeitrag des Guatemalteken Jayro Bustamante sieht man seine Eingebundenheit in die Lebensverhältnisse der Maya-Nachfahren, von denen er handelt, in jedem Moment an. Er glänzt durch einen unverstellten Blick, der seine Figuren niemals bewertet sondern den Zuschauern ihr eigenes Urteil lässt.
Im Mittelpunkt der Handlung (und der Kamera) steht die junge Maria, die mit ihren Eltern irgendwo in Guatemala auf einer Kaffeeplantage lebt, auf der ihr Vater arbeitet. Ein aktiver Vulkan begrenzt nicht nur ihren Lebensraum (dahinter liegt Mexiko), sondern bestimmt auch den Alltag der indigenen Bevölkerung hier: Man betet an seinen Hängen zu den christlichen Heiligen wie zu ihm selbst, bringt ihm Opfergaben, singt ihn in den Schlaf, während der Kaffeeernte.
Marias Eltern wollen sie an den Vorarbeiter Ignacio verheiraten, den Maria kaum kennt, der aber in der Hierarchie weit über ihrem Vater steht und insofern eine gute Partie abgibt. Offen revoltiert sie dagegen nicht, auf subtile Weise aber zeigt der Film ihren Unwillen gegen diese Verbindung und die Sehnsucht danach, aus ihrem alten Leben auszubrechen. Sie versucht, ihren Altersgenosen Pepe zu überzeugen, sie mit in die USA zu nehmen, er jedoch bricht ohne sie auf. Als sich zeigt, dass ihre vorübergehende Annäherung nicht ohne Folgen geblieben ist, droht der gehörnte zukünftige Ehemann, die Familie von der Plantage zu werfen…
Wie die Familie nun auf diese Problematik reagiert, ist auf behutsame Weise inszeniert: Hier gibt es keine hysterische Mutter, keinen schlagenden Vater. Die nach gängigen Filmkonventionen als Bad Guys markierten Eltern bleiben vielschichtige Figuren. Durch einen verblüffenden Gleichmut und Zusammenhalt versuchen Mutter und Vater, pragmatisch, und doch ihrer Tochter gegnüber verständnisvoll, mit der Situation umzugehen. Und selbst der Vorarbeiter Ignacio, Marias zukünftiger Ehemann, der mit Rauswurf droht und durch seine Spanischkenntnisse gegenüber den bloß Kaqchikel sprechenden Kaffeebauern eine enorme Machtstellung einnimmt und diese auch nutzt, wird nicht zum eindimensionalen Ungeheuer gestempelt.
Am Ende gibt es weder eine Katastrophe noch ein Happy End: Das Leben auf der Plantage kehrt zurück in seine routinierten Bahnen. Es wird geheiratet. Einen Ausbruch gibt es nicht.
Ixcanul ist ein ruhiger, einfühlsamer Film, der es versteht auf ganz unaufdringliche Weise ein differenziertes Bild vom Leben der indigenen Bevölkerung Guatemalas zu zeichnen, auch von seinen Härten und Begrenzungen – ohne dabei aber jemals ein vorgefertigtes Urteil aufzudrängen. Eine wohltunde Abwechlsung zum überladenen Pathos von Queen of the Desert oder Nobody wants the Night, hätte er im diesjährigen Wettbewerb allein dafür einen Preis verdient.
Costja
(Bildmaterial: Berlinale Filmstill, Sektion: Wettbewerb)