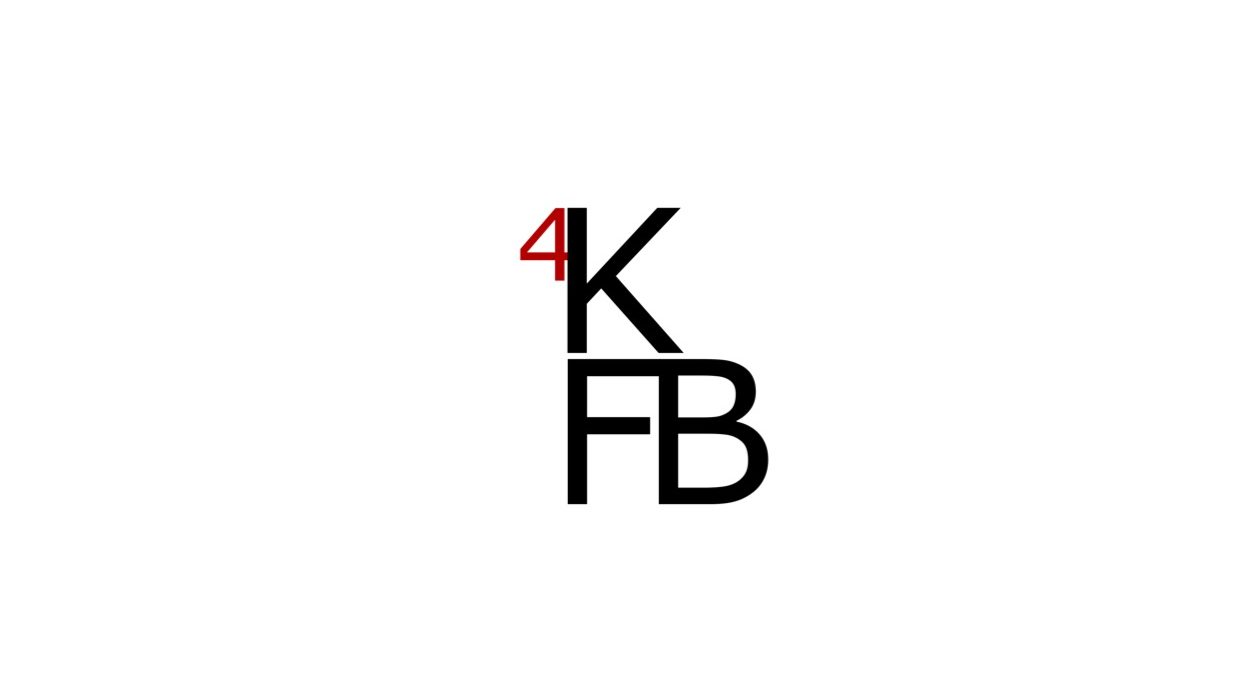In „Swimminpool am Golan“ geht die Regisseurin den Spuren ihrer eigenen Familie durch die Geschichte des 20. Jahrhundert nach. Sie beginnt allerdings nicht chronologisch, sondern mit der Wende: Nach der Öffnung der Mauer kann die junge Esther Zimmerig zum ersten mal nach Israel fahren und trifft dort plötzlich auf Verwandte, die es zuvor nicht gegeben hatte.
Die Erfahrungen sollten sie lange prägen und die Auseinandersetzung mit ihrer jüdischen Identität auslösen. Zum Knackpunkt der Geschichte werden allerdings die Großmutter und Großtante der Regisseurin. Die beiden Schwestern, Lore und Lizzi, gehen im Nazi-Deutschland der 30er Jahre ganz unterschiedliche Wege. Lore stand der zionistischen Bewegung nahe und reiste bald nach Palästina aus, während Lizzi sich dem antifaschistischen Widerstand zugehörig fühlte und nach Berlin ging. Beide überlebten den Krieg, die Verfolgung durch die Nazis und gründeten Familien – zwischen den Kindern der Schwestern durfte es aber nur versteckte Briefwechsel geben, da inzwischen die DDR alle Auslandskontakte unterband. So kontrastiert der Film die Ideale der Familienmitglieder mit den Ideologien in denen sie lebten und diese wiederum mit den Systemen und politischen Umbrüchen der Geschichte. Da ist zum Beispiel der Vater der Regisseurin, der in der DDR als Militärmediziner bei der Abteilung „Aufklärung“ arbeitete. Dessen Schwester wiederum konnte ihm und den anderen nichts erzählen von dem heimlichen Briefwechsel mit den Verwandten in Israel. Heute fühlt sich Cousin Erin verpflichtet seine Kinder in Israel aufzuziehen, während Esther in Berlin lebt und wie ihr Vater und Großvater mit dem jüdischen Glauben wenig anfangen kann. Es ist ein Wechselbad der Widersprüche, das sich nach und nach entfaltet und der Film eine Art Versuch die disparaten Lebensrealitäten, -geschichten und -entwürfe zu einer Familiengeschichte zu formen. Ein gewisses Unbehagen bleibt allerdings in der Frage, ob die offensichtlichen Widersprüche in diesem Film auf die Linie eines Dokumentarfilms zu bringen sind, der ästhetisch relativ konventionell erzählt ist. Auch der Sprung in das Berlin der jüngeren Vergangenheit und zu den politischen und persönlichen Entscheidungen der Regisseurin wirkt dort hart. Es bleibt ein Gefühl des Ungesagten zurück, trotz der mutigen, sehr persönlichen Auseinandersetzung. An einer Stelle spricht eine Verwandte es aus: „Ich kann dir die Fakten erzählen, die Gefühle musst du dir denken.“ Der Film nimmt sich das leider zu selten zu Herzen.
Bildmaterial: achtung berlin filmfestival, Sektion – Wettbewerb – Dokumentarfilm