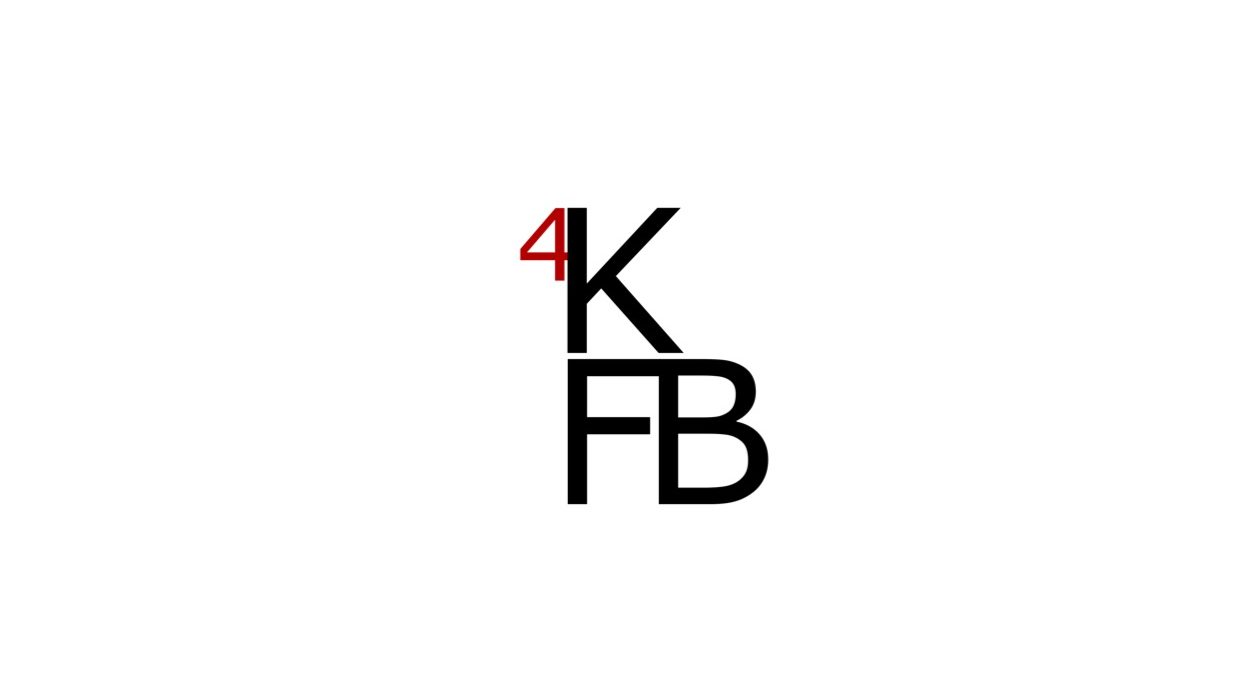…und ich sag dir wer du bist. Das könnte ein Satz sein, der diesen Film beschreibt. Aber was hat man eigentlich gesehen, wenn man diesen Film gesehen hat? Bei wirklich guten Arbeiten ist es ja oft so, dass die Handlung das eigentliche Erleben des Films kaum wirklich begreifbar macht und nur das Knochengerüst bildet für eine vielschichtigere Erfahrung. „Sarah spielt einen Werwolf“ ist genau so ein Fall und führt in die Gefühlswelt einer jungen Frau, deren Erleben ihr manchmal selbst unerträglich wird. Entsprechend unbändig und intensiv ist auch der Film, der mich von Minute Null nicht mehr losgelassen hat.
Vor dem Hintergrund der Schweizer Stadt Fribourg folgt der Film seiner Hauptfigur Sarah aus aller nächster Nähe. Sie ist eine junge Frau, die sich in dieser ganz besonderen Grenzzone bewegt, die man Erwachsenwerden nennt. Und auch sonst ist sie eher am Rande unterwegs: Sie kann mit den meisten anderen Menschen in ihrem Alter wenig anfangen, liest „Romeo und Julia“ und wirft ihren Klassenkameraden vor sich solche Gefühle nicht vorstellen zu können. In ihrer Theatergruppe findet sie die Möglichkeit etwas von dem rauszulassen und auszuprobieren was in ihr steckt. Dort findet sie auch eine Freundin, die sie zu vertstehen scheint. In der Familie bestimmt dagegen der Vater, ein strenger, intellektueller Opernliebhaber, das Geschehen. Mit Sarah hört er Arien im Auto, spricht von der großen Liebe und dem Tod.
Diese Welt des Vaters mit den Wagner-Opern und der Literatur scheint Sarah gleichermaßen Halt zu geben und der Grund für ihr schwierige Situation zu sein, denn ihr Erleben ist eingespannt in ein dichtes Geflecht aus Beziehungen und Erlebnissen, das sie kaum entwirren kann. Ein Gefühl von Geschlossenheit und Enge setzt sich auch in der Stadt fort, deren Vertikalität und mittelalterlichen Architekturen kaum Bewegungsspielraum für Sarah lassen. Ihre Wut äußert sich entsprechend selten und ist immer irgendwie ein Ausweichen von den eigentlichen Problemen. Sie ist wie ihre neue Freundin Alice fasziniert vom Leiden der Märtyrerinnen in den gläsernen Fenstern der Kirche und imaginiert sich selbst als Opfer eines Folterknechts, der in der Stadt sein Unwesen treibt. Als die Mädchen diese Szene der Theatergruppe vorstellen – mit Alice als Folterknecht und Sarah als Opfer – lehnen die Mitspieler das Gesehene ab.
„Was hast du gesehen und was nicht?“ Diese Frage stellt sich also auch für Sarah selbst, die versucht eine Sprache zu finden für das was mit ihr passiert. Aber die Blickstrukturen der Familie, der Theatergruppe und der Stadt lassen das kaum zu. Keins der Medien kann fassen was sie erlebt, weder die Geschichten, die sie schreibt, noch das Spiel in der Theatergruppe. Im Gegenteil scheint das Ungesagte in der Faszination mit den jeweiligen Fiktionen noch mehr an Macht über sie zu gewinnen. Es entsteht eine ungeheure Dynamik zwischen dem was sie spielt und ihrer gelebten Wirklichkeit. Ein wildes Treiben und Getriebenwerden, dem sie kaum entkommen kann – und vielleicht auch nicht entkommen will.
Die Kamera nimmt Sarahs Blick auf und zerlegt die Realität in Einzelteile. Wenn sie neben dem Vater im Auto sitzt, zieht die Stadt mit dem dominierenden Kirchturm an ihr vorbei. Oder silberne Leitplanken blitzen im Dunkeln auf um kurz darauf wieder zu verschwinden. Es sind Bilder für Sarahs innere Haltlosigkeit. Auch der Vater ist mal ein Mund, mal seine Hand neben dem Schaltknüppel, eine Gürtelschnalle – ein Körper, der sich vor Sarah in Fragmente zerlegt. Diese besondere Erzählweise lässt teilhaben an Sarahs Gefühlswelt und ist genauso kontrolliert geführt, wie unbändig. Die Bilder weisen immer auch über sich selbst hinaus, vielleicht auf etwas, das hinter ihren Rändern lauert. So ist das Wichtigste zwar überall gegenwärtig, es wirklich zu sehen bleibt aber jedem Einzelnen überlassen.
Bei allem Spiel mit Realität und Fiktion bleibt Sarah eine 17-Jährige, die Sätze sagt, die alle 17-Jährigen ihren Eltern irgenwann mal sagen oder gesagt haben. Der Film fühlt sich bei all seinen komplexen und dicht gewebten Bezügen sehr nah und verankert an, was wohl vor allem an der Schauspielerin Loane Balthasar liegt, die ihre Figur mit einer Intensität und Präsenz spielt, dass einem in vielen Szenen die Luft weg bleibt. So tritt der bereits zu Beginn erwähnte beste Fall ein: Ein Film, der viel mehr ist als seine unmittelbare Handlung und dabei trotzdem so konkret und präsent, dass sich stundenlang darüber Schreiben und Reden ließe, wenn nicht – so wie jetzt – irgendwann das echte Leben dazwischen käme.
hier geht’s zum Interview mit der Regisseurin!
Bildmaterial: achtung berlin filmfestival, Sektion – Wettbewerb