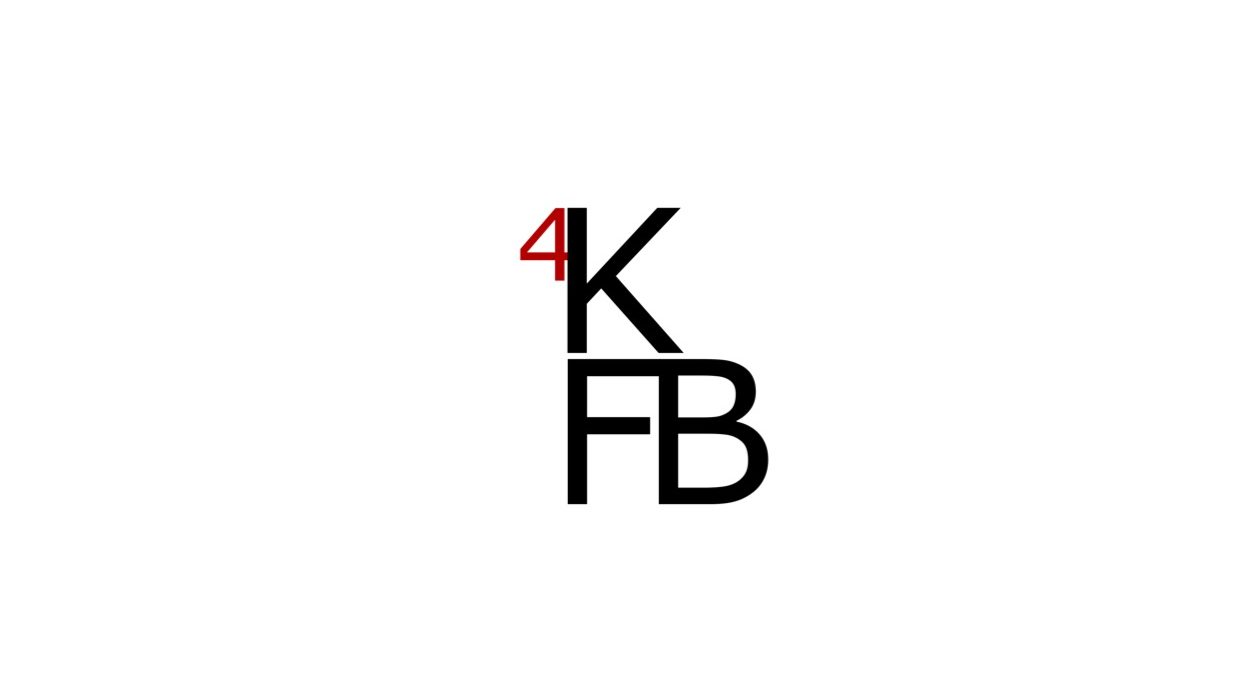Hele Sa Hiwagang Hapis
A Lullaby to the Sorrowful Mystery
Am Donnerstag lief Hele Sa Hiwagang Hapis- A Lullaby to the Sorrowful Mystery im Wettbewerb der Berlinale an. Der Regisseur, Lav Diaz, ist vor allem für seine langen Werke bekannt, die sich meist mit der Geschichte seines Heimatlandes, den Philippinen auseinandersetzen. Für diesen Ansatz wurde Diaz bereits mit zahlreichen Preisen bedacht, zuletzt mit dem Goldenen Leoparden, dem Hauptpreis der Filmfestspiele von Locarno. A Lullaby to the Sorrowful Mystery beschäftigt sich mit der Geschichte von Andres Bonifacio, der als Vater der philippinischen Revolution verehrt wird. Dafür nimmt sich der Film 485 Minuten, in Worten: ACHT STUNDEN UND FÜNF MINUTEN lang Zeit. Das wirkte erstmal natürlich abschreckend. Da ich aber der Meinung war, dass wir diesen außergewöhnlichen Wettbewerbsbeitrag in unserem Blog behandeln sollten, habe ich mich morgens um halb zehn ins Kino gewagt, um eine Kritik und eine Art Erfahrungsbericht zum Erlebnis ‚Achtstundenfilm‘ zu verfassen. Was folgte, war eine der anstrengendsten und – pardon my French – beschissensten Kinoerlebnisse, an die ich mich erinnern kann. Bevor ich besonders auf den Film eingehe, möchte ich nun, als eine Art Selbsttherapie, meine Erlebnisse in Tagebuchform wiedergeben. Nur kurz vorab: Nein, ich habe den Film nicht zu Ende durchgehalten, tut mir Leid euch enttäuschen zu müssen.
Donnerstag morgens. Berlinale Palast.
-0:25: Bald geht es los. Ich nehme gemeinsam mit meinem Buddy Tom, der sich bereit erklärt hat, mir bei dem Screening Beistand zu leisten, Platz auf der linken Seite in einer der vorderen Reihen des zweiten Ranges. Für alle, die noch nie im Berlinale Palast waren: ziemlich links, sehr weit oben.
-0:20: Die Stimmung in den umliegenden Reihen ist gut. Allen Anwesenden ist klar: acht Stunden für einen einzelnen Schwarzweißfilm, während das Festival gespickt ist mit anderen kurzweiligeren Perlen, die wir besuchen könnten? Wir sind alle zumindest ein bisschen verrückt. Und irgendwie auch ein bisschen stolz darauf. „Na, ihr Lieben?“, frage ich in die Runde, und ernte zustimmendes Gemurmel. In der vordersten Reihe gehen Süßigkeiten rum. Solidarität macht sich breit, wir stehen das jetzt gemeinsam durch, auch wenn es schwer wird.
-0:05: Der Cast erscheint fünfzehn Meter unter uns kurz auf der Bühne, nimmt anschließend inmitten der Leute unten im Parkett Platz. Die haben sich ganz schön aufgehübscht, ein kleines bisschen Berlinale-Glamour liegt in der Luft. *hust*
0:00: Es geht los. Überraschung: der Film läuft im 4:3 Format, die Leinwand wirkt also fast quadratisch. Irgendwie altmodisch. Mich beschleicht ein mulmiges Gefühl.
0:20: Die beiden Jungs neben uns haben genug gesehen, verlassen den Saal. Tom und ich schauen uns vielsagend an. Das wird noch richtig übel. Ich bin irgendwie müde, der Film zieht mich wie ein Kraken in den Sekundenschlaf.
0:40: Tom weckt mich von links. „Sorry ich gehe, du bist auf dich allein gestellt.“ Na toll. Ich nehme einen so langen Zug aus meiner Club Mate, dass mir Tränen in die Augen schießen. Oder sind das nur Tränen der Einsamkeit?
1:00: Freunde aus der allmorgendlichen Schlange passieren mich, auch sie geben auf. Ich folge ihnen aus dem Saal. Ein kurzes, verzweifeltes Gespräch später entscheide ich mich: Ich kann und will das nicht zu Ende sehen. Allerdings bleibe ich noch zumindest so lange, bis ich es nicht mehr aushalte. Und bis ich genug Stoff für einen Artikel zusammenhabe.
1:10: Der Film verhöhnt mich. „Die Zeit schreitet zu schnell voran,“ und „es ist am besten, schnell zu sagen, was du zu sagen hast,“ sagt hier der Antagonist in einem Dialog, der kaum Aussagen hat, allerdings acht Minuten dauert. Meine Müdigkeit ist verschwunden, statt ihrer keimt Wut in mir auf.
1:13: Ein einminütiger Close-Up auf eine kleine Eule, die schuhuht. Süß, wenn es nicht so kacke wäre.
1:45: Nach einem zwanzigminütigen Expositions-Dialog, der zahlreiche geschichtliche Ereignisse, Personen- und Ortnamen auf unoriginelle, nahezu karrikierende Art eingeführt hat, gehe ich auf Toilette. Pinkeln muss ich nicht, ich brauche einfach ein wenig Luft. Kurz nachdem ich das Bad betrete, folgen mir fünf weitere Herrschaften, allesamt offenbar auch weniger der Notdurft halber hier, sondern auf der Flucht. Wir nicken uns erschöpft zu und lachen. Da ist es wieder, dieses Gefühl der Solidarität. Vielleicht stehen wir das ja doch alle gemeinsam durch, auch wenn es viel schwerer wird, als wir gedacht hatten.
Ich gehe zurück zu meinem Platz. Um mich rum nur leere Plätze, sogar der junge Philippino aus der Reihe vor mir ist weg. Ich sehe auf die Uhr. Verdammte Scheiße, noch nicht mal zwei Stunden sind um?! Das kann doch alles nicht wahr sein.
2:08: Die Bösewichte (ja, so nenne ich die ab jetzt) erkennt man übrigens daran, dass sie im Dienste Spaniens stehen. Außerdem sagen sie in jedem vierten Satz etwas Fieses und lachen danach böse. Meine Wut weicht langsam Lethargie. Aber davon geht das alles auch nicht schneller rum.
2:26: Ich tippe nun seit einer halben Stunde Notizen für diesen Artikel in mein Smartphone ein. Mein Gesicht ist hell erleuchtet, und es könnte mir nicht egaler sein. Ein Typ rechts von mir telefoniert.
2:40: Ich gehe noch einmal „auf Klo“. Vor dem Saal unterhalte ich mich kurz mit einer Angestellten des Berlinalepalastes über den Film. Liebe Rahel: an dieser Stelle möchte ich mich für die vielen Kraftausdrücke entschuldigen.
3.03: Unterhaltung zweier Bösewichte: „Als ich das erste mal einen Film gesehen habe, war das, als sei ich in eine neue Welt eingetreten.“ -Pause- „Wie interessant.“ -Pause- „ja, HAHAHAHAHA! (böse Lache)“
3:12: Den Protagonisten, Andres Bonifacio, den Mann mit der Gitarre *hint hint* haben wir seit zwei Stunden nicht mehr gesehen. Wo ist der eigentlich, und wer sind diese ganzen Leute? Ein Spanier (einer der Bösen, obviously) erklärt groß und breit (und zum dritten mal), dass die Rebellen sich gegenseitig umbringen und Spanien den Sieg in der Tasche hat. VIVA ESPANA! Ich hasse diesen Film.
3:30: Als die Ehefrau des Andres Bonifacio durch einen Wald läuft und nach ihm ruft, reicht es mir. Ich muss hier raus, so schnell ich kann. Ich packe meine Sachen und haste kopfschüttelnd die Treppe hinauf. Die Hartgesottenen, die noch immer zusehen, nicken mir verständnissvoll zu.
„Geh ruhig, du bist noch jung, geh und genieße dein Leben,“ steht in ihren Blicken, aber vielleicht bewerte ich das auch über. Auf der Treppe außerhalb des Kinosaals reiße ich mir das rote Eintrittsbändchen vom Arm. Als man mir ein neues anbietet, lehne ich dankend ab. Ich atme noch einmal tief durch, und trete nach draußen, ins Licht.
Wie konnte es so weit kommen? Und wieso war das eigentlich alles so schlimm? Das werde ich jetzt in einer kurzen Kritik zum „Film“ erklären.
Vorab ein kurzer Verweis zum Film Genius, der auch im Wettbewerb läuft: hier kommt ein Autor (Jude Law) immer wieder mit sechstausend -Seiten-langen Manuskripten zu seinem Verleger (Colin Firth), der das Buch dann auf sechshundert Seiten runterdampft. Was hat das mit A Lullaby to the Sorrowful Mystery zu tun? Der Film ist Sechstausend Seiten dick, und weit und breit ist kein Verleger in Sicht.
Die absurde Dauer wird durch den Stil des Filmes noch deutlich verschlimmert:
Die Kamera ist nahezu regungslos, pro Szene gibt es nur eine Kameraeinstellung, die sich kaum bewegt und nie zoomt. Eine (unbewegte) Kameraeinstellung ist also zwischen drei und zwanzig (!) Minuten lang, was den Film schmerzhaft statisch macht. Dazu kommt das horrend getimte Spiel der Darsteller: jede Handlung wird erst nach einer ausgedehnten Pause ausgeführt. In einem Dialog scheint es eher, als führe jeder Charakter ein Selbstgespräch. Das Ganze wirkt wie ein extrem schlecht inszeniertes Theaterstück.
Außerdem liegt der Fokus nicht wirklich auf der Handlung sondern… ja, worauf eigentlich? In der ersten Stunde singt Volksheld Bonifacio nicht ein, sondern drei (!) fünfminütige Lieder und klimpert auf seiner Gitarre. Hieran werden sich die meisten Leute, die während der ersten Stunde den Saal verlassen haben, noch erinnern. Da ich länger im Kino geblieben bin (und die Lieder größtenteils verschlafen habe), werde ich mich eher an die platten Antagonisten erinnern (Zitat: „Ich mag die Macht, natürlich will ich sie behalten.“).
Wichtige Ereignisse werden seltsamerweise ausgespart. Da ist Andres von einer Szene auf die nächste plötzlich ein Gefangener anderer Rebellen? Dabei hab ich in der letzten halben Stunde doch gar nicht geschlafen? Da nehmen sie sich ernsthaft acht Stunden, um sie dann mit Pausen und Selbstbeweihräucherung der Bösewichte zu füllen, anstatt die eigentliche Handlung zu zeigen?
All diese Punkte führten dazu, dass sich die dreieinhalb Stunden, die ich durchgehalten habe, sogar noch länger, nämlich eher wie fünf oder sechs Stunden angefühlt haben (immerhin nicht wie acht! HAHAHAHA! (böse Lache)).
Ich war froh, als ich es hinter mir hatte. Allerdings habe ich nach dieser Erfahrung für den Rest der Berlinale Wettbewerbs- und Schwarzweißfilmen abgeschworen.
Ich dachte zwar bereits, dass Cartas da Guerra ein Debakel war, aber A Lullaby to the Sorrowful Mystery setzt sich definitiv die Krone für das schlimmste Kinoerlebnis der Berlinale auf, und ist ein starker Anwärter für meinen persönlichen Hassfilm des Jahres.
Liebe Grüße und bis bald,
Janosch