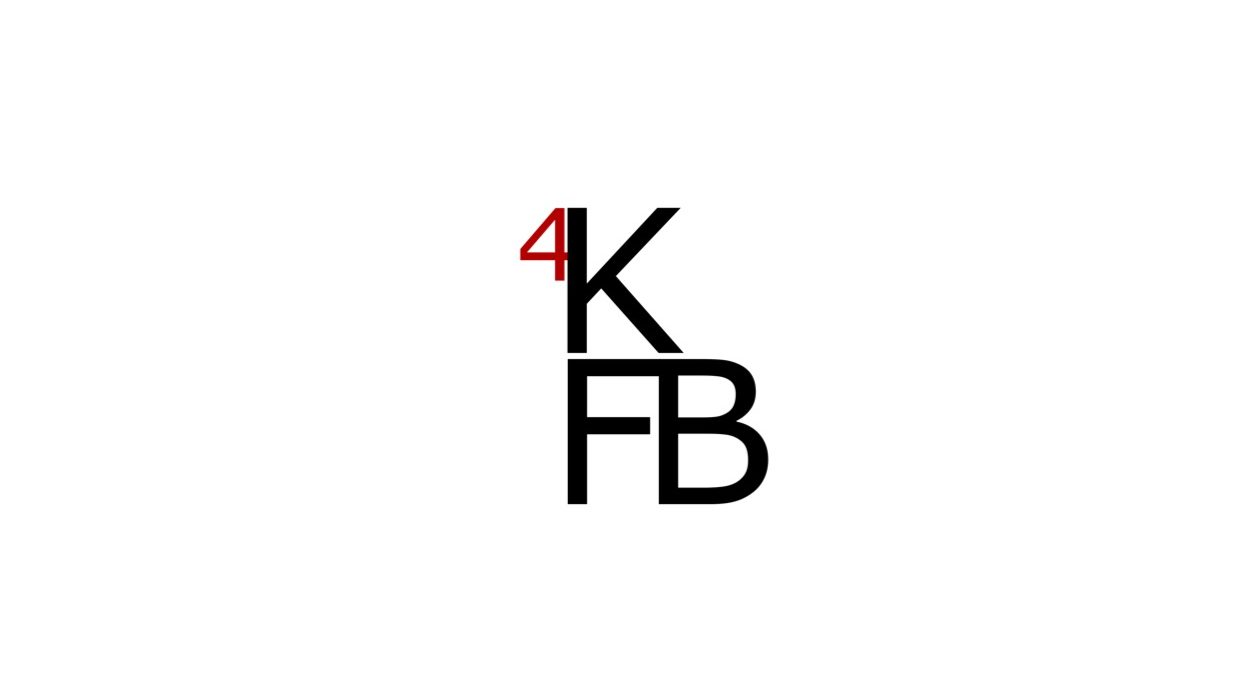Interview – Seit letztem Donnerstag läuft Bettina Blümners neuer Dokumentarfilm „Parcours d’amour“ im Kino (s. unsere Kritik). Darin porträtiert sie Menschen gehobenen Alters in Paris, die sich regelmäßig zum Tanzen und Flirten treffen. Vor der Kamera erzählen sie aus ihrem Leben und von der Liebe. Im Gespräch erzählt die Regisseurin, die 2006 mit ihrem ersten Langfilm „Prinzessinnenbad“ bekannt wurde, von den Entstehungs-bedingungen ihres neuesten Werkes und den Grundsätzen ihrer Arbeit.
————————
4Kinder: Frau Blümner, wie sind Sie dazu gekommen, einen Film über die Besucher Pariser Tanzcafés zu machen?
Blümner: Es gab mehrere Ideen und Ansätze diesen Film zu realisieren. Da war der Taxiboy Michel, den ich bereits 2008 in Paris kennen gelernt habe. Im Rahmen einer Spielfilmrecherche habe ich mich nach käuflichen Tanzpartnern umgeschaut und ihn getroffen. Trotz eines phantastischen Drehbuches ist dieser Spielfilm leider nie zustande gekommen. Das Thema und den Kontakt zu Michel habe ich im Kopf behalten. Schon damals war ich oft in Paris und habe Freunde besucht, die direkt um die Ecke des [Tanzcafés] „Le Memphis“ wohnen. Dort habe ich die älteren, gut gekleideten Rentnerinnen und Rentner gesehen, die sich täglich um 13:30 Uhr in eine lange Schlange einreihten. Um 14 Uhr öffnet nämlich das Tanzcafé. Ich fand es interessant und spannend, diese Welt zu erkunden. Und dann bin einfach mal reingegangen. Man kommt also am helllichten Tag in so eine dunkle, rote, Plüsch-Höhle – gerade das Memphis hat ja diesen besonderen Flair – und ist dann in einer komplett anderen Welt. Das hat mir gut gefallen.
Am Anfang stand also keine Idee oder Botschaft, die Sie unter die Leute bringen wollten?
Nein, nein. Schon bei „Prinzessinnenbad“ war der Ausgangspunkt der Ort, das Prinzenbad. Ich gehe dort selbst schwimmen und finde es ist ein besonderer Ort. Oft finde man an besonderen Orten interessante Menschen. So war es auch bei diesem Film.
Nun spielt der Film ja vermutlich nicht umsonst in Paris. Diese Szene, die Sie beschreiben, diese Etablissements, Tanzcafés für ältere Menschen, gibt es so etwas nur in Frankreich oder wäre das auch in Deutschland denkbar?
Das kann ich mir schon vorstellen – im Grunde sitzen wir ja gerade in einem (Clärchens Ballhaus in Berlin Mitte). Natürlich habe ich mich auch hier in Berlin umgeschaut. Aber in Paris hatte ich bereits recherchiert und spürte dort diesen besonderen Charme. Ich hatte außerdem das Gefühl, dass es in Paris viel mehr Tanzcafés gibt als in Berlin – so um die zehn, fünfzehn – dass die Tanzteeszene aktiver, größer und noch präsenter ist als hier. Jeden Nachmittag traf ich dieselben Personen, nur in unterschiedlichen Tanzcafés. Aber wenn man intensiv suchte, würde man sicherlich auch hier Menschen finden, die sich regelmäßig zum Tanzen treffen. In den Zwanziger Jahren gab es in Berlin sehr viel mehr Tanzcafés, in Paris hat sich diese Tradition einfach stärker gehalten.
Verstehen Sie den Film auch als Plädoyer gegen den Jugendwahn?
Grundsätzlich versuche ich in meinen Filmen nicht, Plädoyers für oder gegen etwas zu entwerfen. Ich orientiere mich an Menschen, vor allem an meinen Protagonisten, und schaue, was diese zu sagen haben, was sie erlebt haben. Ich kann auch nicht eindeutig beurteilen, ob das, was sie sagen, allgemeingültig ist oder nur für sie steht. Ich würde auch nicht behaupten, dass zum Beispiel mein Film „Prinzessinnenbad“ eine Milieustudie ist. Es geht nicht um ein Milieu, sondern um Geschichten konkreter Menschen. Ob das repräsentativ ist oder nicht, das sollen andere – vielleicht die Kritiker – entscheiden. Aber ich würde mir nicht anmaßen zu sagen, das sei jetzt ein Plädoyer für irgendwas. Ich gehe bei meiner Arbeit ergebnisoffen heran: Gucke mir an, was da ist, was mich interessiert und versuche das dann sichtbar zu machen.
Der Titel des Films steht im Plural: „Parcours d’amour”. Versteckt sich darin vielleicht doch so etwas wie eine Botschaft? Ein Manifest für amouröse Vielfalt? Ihr Film zeigt ja nicht nur, dass Liebe kein Alter kennt, sondern auch ein breites Spektrum von Zugängen zu dem, was Liebe sein kann… Kam es Ihnen darauf an oder ist das eher Zufall?
Das ist nicht immer eindeutig. Bei einem Dokumentarfilm mache ich vorab eine Recherche, dann schreibe ich die Ergebnisse und meine (Wunsch-)Vorstellungen auf und stelle mir vor was passieren könnte. Vieles davon trifft tatsächlich ein, manches nicht. Der Titel „Parcours d’amour“ bezeichnet die Höhen und Tiefen, das Auf und Ab der Liebe, im Sinne eines Hindernislaufs. Die Protagonisten haben ja letztlich ähnliche Sehnsüchte wie die Mädchen aus „Prinzessinnenbad“, bloß dass sie eben 50, 60 oder 70 Jahre älter sind. Außer dem Alter hat sich nicht so viel geändert.
Apropos Auf und Ab: Es gibt ja sehr viele Szenen, in denen die Protagonisten über ihre Vergangenheit sprechen. Welche Rolle spielen für Sie diese Rückschauen im Film?
Das fand ich sehr spannend. Zum Beispiel die Szene von Christiane, die ja wirklich sehr ausführlich beschreibt, wie ihre Mutter ihre erste große Liebe, zu einem „kleinen Schweizer“, verhindert hat. Für sie ist es so präsent, als wär es erst gestern gewesen. Das hat mich sehr mitgenommen. Fast alle Protagonisten haben negative Erfahrungen in ihrer Vergangenheit und Kindheit und sie erzählen im Film sehr offen davon. Das ist doch interessant, dass diese Ereignisse und Erfahrungen, die teils schon viele Jahrzehnte zurückliegen, trotz des hohen Alters noch so präsent sind.
Das hat ja auch etwas Aufmüpfiges: dass diese Menschen trotz aller Rückschläge ihre Lebensfreude nie verloren haben, dass sie weiter ihre Tanzrunden drehen…
Ja, das Tanzen, das Flirten, die Geselligkeit, das hält sie am Leben
Hatten Sie den Eindruck, dass gerade aufgrund bestimmter schmerzhafter Erfahrungen, die Lust, sich auch im Alter nochmal ins Leben zu stürzen, umso größer ist?
Interessanter Gedanke. Darüber habe ich noch nie nachgedacht, aber das kann gut sein.
Wie haben Sie denn Ihre Protagonisten ausgewählt?
Ich habe sehr häufig die Pariser Tanzcafés besucht. Gerade als jüngerer Mensch fällt man da natürlich auf, alle wollten wissen, was man an diesem Ort sucht und woher man kommt. Ich habe einige Runden tanzen müssen um ins Gespräch zu kommen – obwohl ich gar nicht so gut tanzen kann. Irgendwann kennt man sich dann vom Sehen. Mit einigen potentiellen Protagonisten habe ich mich dann auf einen Kaffee verabredet und gefragt, ob sie Lust hätten mitzumachen. Manche hatten auch kein Interesse.
Bei den Dreharbeiten hat sich schnell heraus kristallisiert wer weiter machen möchte und wer zu schüchtern ist oder Angst vor der Kamera hat. Und so kristallisierten sich dann Stück für Stück die Protagonisten heraus. Anfangs habe ich auch noch mit „Nicht –Tanzenden“ Aufnahmen gemacht, die aber am Ende nicht mehr ins Konzept gepasst haben. Wie bei „Prinzessinnenbad“: die Bademeister, die Präsenz des Schwimmbads, das Wasser wird im Frühling in die Schwimmbecken eingelassen – sehr schöne, visuell starke Bilder, die man aber am Ende gar nicht braucht, weil die Protagonisten viel stärker sind. Bei „Parcours d’amour“ habe ich zum Beispiel den Besitzer des „Le Memphis“ gefilmt. Erci Gay liebt seinen Club über alles. Es ist ein Familenbetrieb, er hat ihn von seinem Urgroßvater geerbt . Monsieur Gay kennt jede Ecke seines Clubs, kann zu jeder Tischlampe eine lange Geschichte erzählen. Diese Erzählungen hätten einen eigenen Film hergegeben. Aber am Ende habe ich mich auf ein anderes Thema konzentriert: Die Suche nach Liebe und Nähe im Alter, es geht um Sehnsucht, Lebensfreude, aber auch das Thema Vergänglichkeit spielt angesichts des Alters eine wichtige Rolle.
Diejenigen, die in Ihrem Film gelandet sind, waren die sofort Feuer und Flamme oder hat es da Überzeugungsarbeit gebraucht? Immerhin zeigen Sie ja auch sehr intime Momente. Wie schaffen Sie es, die Leute in dieser Vertraulichkeit zum Mitmachen zu bewegen, ohne, dass sie sich verstellen?
Der Schlüssel ist Sympathie meinem Team und mir gegenüber. Meine Protagonisten lernen mich kennen, ich lerne sie kennen, gegenseitiges Vertrauen ist sehr wichtig. Je stärker der Kontakt zu den Protagonisten ist, desto besser eigentlich.
Aber es funktioniert nicht mit jedem?
Manche Menschen sind kamerascheu und drehen sich sozusagen intuitiv weg – ich gehöre übrigens auch dazu und mag nicht so gern gefilmt werden. Andere Menschen hingegen genießen das Gefilmtwerden. Das ist von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Außerdem ist es wichtig, dass meine Protagonisten sich ganz natürlich vor der Kamera bewegen, sich nicht verstellen. Und generell muss man gucken, ob Menschen Lust haben oder nicht. Wenn jemand keine Lust hat mitzumachen, dann bringt das alles überhaupt nichts. Es muss so eine gegenseitige Neugier da sein. Und es sollte allen Beteiligten auch Spaß machen.
Bei zwei Ihrer Protagonisten, den beiden alten Frauenhelden Gino und Eugène, hat man ja das Gefühl, sie flirten auch ein wenig mit der Kamera. Verändert das nicht das Verhalten der Menschen, wenn sie den Blick der Kamera auf sich spüren?
Klar, irgendetwas macht das schon, aber ich hatte bei den beiden nicht das Gefühl, dass ihr Verhalten nicht mehr authentisch war. Ich hatte, auch dank der intensiven Vorbereitung, den Eindruck, dass sie sich ähnlich oder genauso verhalten, wenn die Kamera nicht da ist. Das ist natürlich total wichtig. Wenn ich merke, dass irgendwas gespielt wird, dann bekomme ich direkt so ein komisches Gefühl, dann verlier ich das Interesse für eine Person. Im Grunde ist das ähnlich wie beim Spielfilm: Einem Darsteller, der sehr extrovertiert spielt, muss man vielleicht sagen, hey, hier ist gerade gar nichts mehr echt, jetzt müssen wir erst mal alles reduzieren. Auch beim Dokumentarfilm muss man das Gefühl haben, die Geschichte kommt von Herzen. Wenn es sich vor der Kamera nicht mehr echt anfühlt, dann ist es wahrscheinlich nicht der geeignete Protagonist für meinen Film. Im fertigen Film würde man das Künstliche zwangsläufig spüren.
Über welchen Zeitraum haben Sie Ihre Protagonisten denn begleitet?
Ich war oft in Paris und habe mich mit den in Frage kommenden Tanzenden getroffen. Meine Regieassistentin Barbara Schölnberger hat mich bei der finalen Recherche sehr unterstützt. Der ganze Prozess von der ersten Recherche bis zum Drehbeginn hat sehr lange gedauert. So lange, dass ich teilweise neue Protagonisten suchen musste. Es gab also mehrere Phasen. Nach meiner ersten Recherche ohne Finanzierung, lag das Projekt erst Mal in meiner Schublade. Dann kam der Produzent Peter Schwartzkopf auf mich zu und meinte, er würde sehr gerne mit den Referenzmitteln vom Deutschen Filmpreis für „Prinzessinnenbad“ sowie Eigenmitteln einen weiteren Film mit mir drehen. Er fand meine Idee sehr schön und stieg ein. In der Zwischenzeit waren einige Protagonisten zu alt geworden. Sie fühlten sich körperlich nicht mehr in der Lage beim Filmdreh mitzumachen. Die Dreharbeiten dauerten dann einen Sommer, im Herbst gab es eine Pause und im Winter einen letzten Drehblock.
Im Vergleich zur Arbeit mit den Jugendlichen in „Prinzessinnenbad“: Brauchte es mehr Zeit, mit den alten Menschen warm zu werden, oder weniger? Oder nimmt sich das gar nichts?
Gute Frage. Grundsätzlich gilt: Je mehr Zeit man miteinander verbringen kann, desto besser. Damit ich den Menschen, mit denen ich arbeiten will, erklären kann, was ich mache und sie das auch verstehen, und ich verstehe, was sie machen. Letztlich kann ich gar nicht genau bemessen, wie viel Zeit dieser Prozess mit wem benötigt, das ist vor allem so eine Gefühlssache. Allerdings suche ich mir ja meine Protagonisten auch danach aus, dass sie von sich aus offen sind, dass sie bereit sind, etwas von sich preiszugeben – ansonsten würde der entstehende Film vermutlich schnell langweilig werden. Meine Arbeit lebt unter anderem von den persönlichen Geschichten meiner Protagonisten.
Gab es denn während der Vorbereitung Momente, wo Sie das Gefühl hatten, verdammt, diesen Moment hätte ich jetzt gern auf Kamera gehabt, und dann kommt der nicht wieder?
Nicht wirklich. Als Regisseurin kann ich Themen ja auch immer wieder neu ansprechen. Wenn ich zum Beispiel die Geschichte von der Mutter Christianes verpasst hätte, dann gibt es von den beiden noch fünf andere Geschichten, die vielleicht ähnlich tragisch sind. Ich glaube, dass sich ganz viel auftut bei Dreharbeiten – man braucht bloß Geduld und Zeit und am Ende kommt es auf diesen einen Satz dann gar nicht an. Es geht vor allem um das richtige Gefühl und das Transportieren von Geschichten. Wenn nicht die eine, dann eine andere. Klar, wenn die Kamera aus Versehen nicht aufgenommen hat – das kommt natürlich immer mal wieder vor – , dann kriegt man erst mal eine totale Krise, aber letztlich glaub ich, dass man die Essenz dessen, was der Film braucht und was die Menschen an Geschichten in sich tragen, auf die ein oder andere Weise in ganz verschiedenen Situationen bekommen kann.
Haben Ihre Protagonisten denn den Film schon gesehen?
Nein, bisher nur Ausschnitte, den ganzen Film noch nicht. Wir haben seit kurzem einen französischen Verleiher, der auch zwei eigene Kinos in Paris betreibt. Der Film kommt Anfang 2016 in Frankreich in die Kinos. Und spätestens dann hoffe ich auf eine gebührende Paris-Premiere zusammen mit meinen Protagonisten. Der Verleiher Torsten Frehse und ich hatten auch überlegt, ob man die Protagonisten zur Berlinpremiere einfliegen lassen könnte, aber das scheiterte sowohl am verfügbaren Budget als auch am Gesundheitszustand der Protagonisten. Der Rohschnitt ist zumindest schon mal gut angekommen. Gino zum Beispiel hatte ich während der letzten Drehphase die Aufnahmen von ihm aus dem Sommer gezeigt. Da meinte er dann immer nur, “ah, je suis beau” und fand sich super (lacht). Also der Inhalt, seine Aussagen, haben ihn gar nicht so sehr interessiert, aber er fand zumindest, dass er im Film optisch ganz toll aussieht…
Apropos Gino: Es gibt ja doch einen gewissen Männerüberhang. Wie ist es dazu gekommen?
Wahrscheinlich lag es daran, dass die Männer im Tanzcafé von sich aus auf mich zugekommen sind; weil sie mit mir tanzen wollten. Ich habe anfangs tatsächlich mehr männliche Bekanntschaften gemacht, als weibliche. Dafür haben dann die Nebenfiguren, die Tanzpartnerinnen von Taxiboy Michel einen großen Raum bekommen, die ja auch die weibliche Perspektive ins Spiel bringen. Und dann gibt es ja noch die beiden weiblichen Protagonistinnen Christiane und Michelle.
Die Vorstellungen zum Thema Liebe scheinen mitunter doch recht stereotyp verteilt zu sein: Auf der einen Seite hat man die beiden Freundinnen Christiane und Michelle, die nach etwas Ernsthaftem suchen, auf der anderen Seite die beiden Männerfreunde Gino und Eugène, die gar nicht genug Frauen kriegen können…
Ich war selber erstaunt. Ich hatte damit gar nicht gerechnet. Grundsätzlich bin ich gegen Klischees und hätte sehr gern das Gegenteil dargestellt, aber in dem Fall war es einfach so, dass die Frauen im Film eher auf der Suche nach einer romantischen Liebe waren, als die Männer. Was ja auch spannend ist. Ich dachte eigentlich, dass sich das vielleicht umkehrt oder verändert im Alter. Andererseits spürt man auch bei Eugène eine gewisse Melancholie. Und Gino hat ja eigentlich eine feste Freundin, mit der er sehr glücklich zu sein scheint – auch wenn er immer sagt, er wolle jede Frau haben. Es gibt da eine Menge Widersprüche und ist durchaus nicht eindeutig, ungebrochen. In diesen scheinbar stereotypen Anordnungen gibt es dann doch immer wieder Überraschungen und Widersprüche. Das macht den Film so spannend.
Auf Ihr Gesamtwerk bezogen: Gibt es da ein durchgehendes Motiv, eine Frage, die Sie besonders interessiert? Ich hatte den Eindruck, Sie arbeiten sich so ein bisschen durch verschiedene Lebensabschnitte: Die Jugend in „Prinzessinnenbad“, das mittlere Alter bei den Männern aus „Halbmondwahrheiten“ und nun das hohe Alter der Pariser Tanzcafébesucher…
Stimmt, da ist was dran. Das war mir gar nicht so bewusst – aber jetzt, wo Sie’s sagen: Vielleicht arbeite ich mich wirklich durch die verschiedenen Lebensphasen.
/////////////////////////