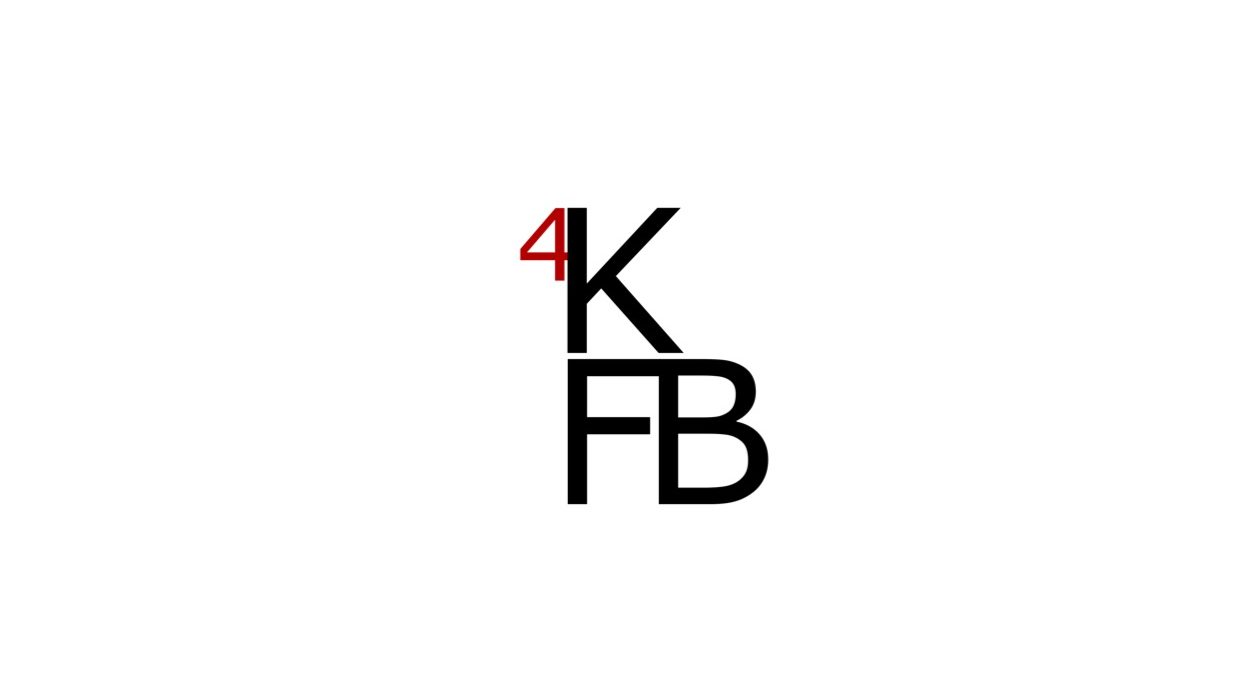Wenn es um die großen Werke der modernen Literatur (und um Literatur überhaupt) geht, wird oft die Arbeit der Lektoren vergessen, die in diese Bücher eingeflossen ist und sie oft erst zu dem gemacht hat, was die Öffentlichkeit dann als ‚geniales‘ Werk bestimmt. In dieser Hinsicht ist der Ansatz von Genius (Regie: Michael Grandage) durchaus lobenswert: Er zeigt beispielhaft die Bedeutung des Lektorats für die Entstehung guter Bücher, den wesentlichen Anteil, den es am ‚Genie‘ eines Werks hat, am Beispiel von Max Perkins (‚Entdecker‘ von Hemingway und Fitzgerald) und seinem ambivalenten Verhältnis zum Jungautor Thomas Wolfe in den späten 1920er Jahren. Wie gesagt, der Ansatz ist lobenswert – aber was der Film daraus macht, ist es leider ganz und gar nicht.
Die Probleme beginnen schon mit dem Vorspann: „a true story“ steht da; nicht etwa „based on…“, oder Ähnliches, wie man es häufiger bei Filmen zu lesen bekommt, die auf historischen Personen oder Ereignissen beruhen, nein – „a true story“. Diese Behauptung, die für sich genommen schon abwegig genug ist, bedenkt man, dass jede Filmaufnahme, ja selbst jedes Foto immer schon Interpretation ist, wird noch grotesker, wenn man im Absoann zu lesen bekommt, der Film basiere auf dem Buch soundso von soundso. Was für eine Anmaßung, also!
Man hat diese erste Pille kaum geschluckt, noch ist kein Bild erschienen, da setzt bereits die nostalgisch-süßliche Musik ein, die das Filmgeschehen für den Rest seiner Dauer fast ununterbrochen untermalen wird – eine Mischung aus Downton-Abbey-Score und Märchenfilm. Was hat die hier zu suchen, fragt man sich, erst recht, wenn einen Moment später die Jahreszahl 1929 eingeblendet wird, das Jahr des Black Friday, Beginn der Weltwirtschaftskrise… Mit welcher Berechtigung muss uns der Film hier auf heile Welt einstimmen? Vielleicht gibt es da so eine Art Nostalgie-Reflex bei historisch angesiedelten Stoffen, der den rosigen Blick auf die ‚gute alte Zeit‘ auch musikalisch ausgedrückt wissen will. Als müsse bereits im Voraus absolut klar gemacht werden, dass von diesem Film ganz gewiss keine emotionale Zerrüttung zu erwarten ist. Immerhin, dieses Versprechen hält er ein.
Kommen wir zu den Figuren – immerhin gefällt sich der Film vor allem als Geschichte der persönlichen Beziehung zwischen zwei ‚genialen‘ Persönlichkeiten. Trotz eines hochkarätigen Casts – Colin Firth, Jude Law, Nicole Kidman (ja, auch die soll ja noch hochgehandelt werden) – bleiben die Charaktere leider zugleich blass und überzeichnet – vor allem der Autor selbst, Thomas Wolfe (Jude Law), das Abziehbild von einem ‚Genie‘: einerseits permanent bemüht overacted, andererseits seltsam uninteressant, charismalos, wie eine überdekorierte Hülle um einen leeren Kern. Das wirkt sich auch auf die Beziehung zwischen den Figuren aus: nach fünf Minuten schwören sie sich schon Freundschaft und man fragt sich, was Mr. Perkins eigentlich an diesem dahergelaufenen Hanswurst findet, was die obsessive Abhängigkeit der anderen Figuren von ihm bewirken soll; genauso abrupt wirkt der Bruch, der sich schließlich ereignet (als man sich schon wünscht, der Film sei längst zu Ende). Dabei ist es gar nicht unbedingt so, dass die Darsteller schlecht spielen würden (außer vielleicht Nicole Kidman, aber das ist spätestens nach der letzten Berlinale nichts Neues und ihre Rolle als Theaterfrau scheint die dargebotene Oberflächlichkeit wenigstens in gewissem Maße zu legitimieren), sie geben sich alle Mühe (sogar ein bisschen zu viel, vielleicht); der Mangel der Figuren an Profil ergibt sich vielmehr aus dem Drehbuch, das ihnen keinerlei Tiefe, keine Komplexität gestattet. Diesen Mangel spürt man umso deutlicher, wenn im Kontrast dazu Scott Fitzgerald (Guy Pearce), der in nur wenigen Szenen (eine davon herausragend) auftritt, als die wesentlich interessantere Figur erscheint.
Schließlich mystifiziert der Film die längste Zeit über die eigentliche Textproduktion, die gemeinsame Lektoratsarbeit. Nur in einer einzigen – dafür wirklich gelungenen – Szene lässt sich ddas Drehbuch dazu herab, sich der verhandelten Literatur an einem konkreten Beispiel anzunehmen.
Alles in allem ist der Film nicht nur zu lang, sondern über weite Strecken schlicht langweilig und wird erdrückt unter seinem weichgespülten Pathos – echte Konflikte lässt der Plot einfach nicht zu: Perkins‘ Familienleben ist lupenrein, seine Frau verzeiht im jede Überstunde, seine Töchter lieben ihn trotz permanenter Abwesenheit und Perkins selbst ist ein moralisch einwandfreier Puritaner, mit weichem Herzen. Der echte Perkins selbst hätte dem Film mutmaßlich eine ziemlich überladenen Form attestiert: hätten sich die Produzenten mal an ihm ein Beispiel genommen…
Um dem Film nicht unrecht zu tun, seien neben der bereits erwähnten Lektoratsszene und der Fitzgerald-Figur noch seine beiden anderen Lichtblicke erwähnt: eine schöne kleine Szene mit Hemingway in Anglermontur, wie er dem Empörkömmling Wolfe in absentu die Leviten liest, sowie eine ganz hübsche Jazz-Musik-Analogie für den Unterschied zwischen klassischen und modernen Formen in der Literatur; but that’s it, basically.
Ironischerweise genug fehlt Genius selbst genau jener Mut zu künstlerischer Freiheit, unkonventionellem Vorgehen, der womöglich so etwas wie ‚geniales‘ Potential (was immer das genau sein soll) entfalten könnte – was ihn allein noch nicht gehindert hätte, ein solider Film zu werden. Viel schlimmer ist, dass es ihm gerade an jener formalen Strenge und Einfühlsamkeit ermangelt, die die Qualitäten seiner Hauptfigur ausmachen. Eins ist klar: Wäre Max Perkins ein Filmkritiker gewesen, hätte er hier ausgiebig seinen Rotstift angesetzt.
Constantin